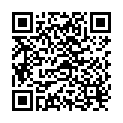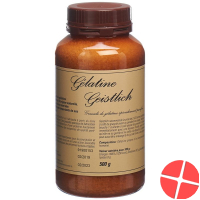Saquinavir - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Saquinavir und den anderen QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Saquinavir und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Saquinavir ist die gleichzeitige Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen kontraindiziert.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Selpercatinib - Pimozid
Selpercatinib ist ein schwacher CYP3A-Inhibitor und kann daher die Bioverfügbarkeit von Pimozid erhöhen. Zudem können sich die proarrhythmischen Wirkungen von Selpercatinib und Pimozid addieren oder potenzieren.
Verstärkte Wirkungen von Pimozid möglich/erhöhtes Risiko von Arrhytmien
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib kann möglicherweise die Wirkungen von Pimozid verstärken. Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, ist das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Torsades de pointes können mit Schwindel und Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Pimozid ist die gleichzeitige Behandlung mit QT-Zeit verlängernden Substanzen kontraindiziert.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
QT-verlängernde Substanzen - Piperaquin
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängern Substanzen und Piperaquin kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Piperaquin ist die gleichzeitige Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen kontraindiziert.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
QT-verlängernde Substanzen - Lumefantrin
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen und Lumefantrin kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformationen von Lumefantrin ist die gleichzeitige Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen kontraindiziert.
Laut anderen Fachinformationen ist bei gleichzeitiger Behandlung mit Lumefantrin Vorsicht geboten. Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Panobinostat - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Panobinostat und den anderen QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Panobinostat und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Panobinostat wird die gleichzeitige Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Selpercatinib - Starke CYP3A-Induktoren
Selpercatinib wird haupsächlich durch CYP3A abgebaut; starke CYP3A-Induktoren können daher dessen Abbau beschleunigen und die Exposition von Selpercatinib vermindern.
Bei gleichzeitiger Anwendung von Rifampicin sank die AUC von Selpercatinib um 70%.
Die Enzyminduktion kann einige Tage bis Wochen nach Absetzen des Enzyminduktors anhalten.
Verminderte Wirksamkeit von Selpercatinib möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit starken CYP3A-Induktoren kann es zu verminderter Wirksamkeit von Selpercatinib kommen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und starken CYP3A-Induktoren wird im Allgemeinen nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Selpercatinib - Mässige CYP3A-Induktoren
Selpercatinib wird haupsächlich durch CYP3A abgebaut; mässige CYP3A-Induktoren können daher dessen Abbau beschleunigen und die Exposition von Selpercatinib vermindern.
Die Enzyminduktion kann einige Tage bis Wochen nach Absetzen des Enzyminduktors anhalten.
Verminderte Wirksamkeit von Selpercatinib möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mässigen CYP3A-Induktoren kann es zu verminderter Wirksamkeit von Selpercatinib kommen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und mässigen CYP3A-Induktoren wird im Allgemeinen nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Selpercatinib - Enzalutamid
Selpercatinib wird haupsächlich durch CYP3A abgebaut; Enzalutamid kann daher als starker CYP3A-Induktor dessen Abbau beschleunigen und die Exposition von Selpercatinib vermindern.
Umgekerht kann Selpercatinib als schwacher CYP2C8-Inhibitor die Bioverfügbarkeit von Enzalutamid (CYP2C8-Substrat) erhöhen.
Verminderte Wirksamkeit von Selpercatinib möglich/verstärkte Wirkungen von Enzalutamid möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung von Selpercatinib und Enzalutamid kann es zu verminderter Wirksamkeit von Selpercatinib, aber auch zu verstärkten unerwünschten Wirkungen von Enzalutamid kommen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und Enzalutamid wird im Allgemeinen nicht empfohlen; dies v.a. aufgrund des Wirkverlustes von Selpercatinib.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Selpercatinib - Dabrafenib
Selpercatinib wird haupsächlich durch CYP3A abgebaut; Dabrafenib kann als mässiger CYP3A-Inhibitor dessen Abbau beschleunigen und die Exposition von Selpercatinib vermindern.
Umgekerht kann Selpercatinib als schwacher CYP2C8-Inhibitor die Bioverfügbarkeit von Dabrafenib erhöhen.
Verminderte Wirksamkeit von Selpercatinib möglich/verstärkte Wirkungen von Dabrafenib möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung von Selpercatinib und Dabrafenib kann es zu verminderter Wirksamkeit von Selpercatinib, aber auch zu verstärkten unerwünschten Wirkungen von Dabrafenib kommen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und Dabrafenib wird im Allgemeinen nicht empfohlen; dies v.a. aufgrund des Wirkverlustes von Selpercatinib.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Nisoldipin - CYP3A-Inhibitoren
Nisoldipin ist ein CYP3A-Substrat, CYP3A-Inhibitoren können daher seine Plamakonzentrationen erhöhen. Ketoconazol erhöhte die AUC von Nisoldipin um mehr als das 20-Fache.
Verstärkte Wirkungen von Nisoldipin
Die gleichzeitige Behandlung mit CYP3A-Inhibitoren kann die Wirkungen von Nisoldipin verstärken (Blutdruckabfall, Tachykardie, Kopfschmerzen, verstärkte Knöchelödeme, Flush).
Die gleichzeitige Behandlung mit Nisoldipin und CYP3A-Inhibitoren wird nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Clofarabin - Hepatotoxische Substanzen
Clofarabin ist hepatotoxisch; Fälle von Hyperbilirubinämie, Venenverschlusserkrankung, erhöhten Transaminasen und Leberversagen wurden gemeldet. Die hepatotoxischen Wirkungen könnten sich addieren.
Erhöhtes Risiko für Hepatotoxizität
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Clofarabin und hepatotoxischen Substanzen kann sich das Risiko für Hepatotoxizität erhöhen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Clofarabin und hepatotoxischen Substanzen sollte möglichst vermieden werden.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
QT-verlängernde Substanzen - Protozoenmittel
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen und einigen Protozoenmitteln kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit mehreren QT-verlängernden Substanzen soll möglichst vermieden werden, andernfalls sollen Elektrolytstörungen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Domperidon - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängern Substanzen und Domperidon kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Domperidon und weiteren QT-verlängernden Substanzen ist Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Pitolisant - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Pitolisant und den anderen QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko von Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Pitolisant und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Pitolisant ist bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Ranolazin - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Ranolazin und den anderen QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Eine Populationsanalyse bei Patienten und gesunden Freiwilligen zeigte, dass das QTc um etwa 2,4 ms pro 1000 ng/ml Ranolazin stieg, was bei einer Dosis von 500–1000 mg Ranolazin zweimal täglich einem Anstieg von 2–7 ms entspricht.
Pharmakokinetische Interaktionen mit Plasmakonzentrationserhöhungen der Arzneistoffe können hinzukommen.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Ranolazin und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Ranolazin ist bei gleichzeitiger Behandlung mit weiteren QT-verlängernden Substanzen Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Substrate (CYP2C8) - Selpercatinib
Selpercatinib ist ein mässiger CYP2C8-Inhibitor und kann daher die Bioverfügbarkeit von CYP2C8-Substraten erhöhen: Selpercatinib erhöhte die AUC von Repaglinid um 91% und die Cmax um 188%.
Verstärkte Wirkungen der CYP2C8-Substrate möglich
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib kann möglicherweise die Wirkungen von sensitiven CYP2C8-Substraten verstärken.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und sensitiven CYP2C8-Substraten wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls sollen die Patienten sorgfältig auf verstärkte Wirkungen des CYP2C8-Substrats überwacht werden und ggf. eine Dosisanpassung vorgenommen werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Selpercatinib - H2-Rezeptorantagonisten
Die Erhöhung des Magen-pH-Wertes kann die Löslichkeit und damit die Absorption von Selpercatinib vermindern.
Bei gleichzeitiger Behandlung von Ranitidin mehrmals täglich, 2 Stunden nach Selpercatinib verabreicht, wurden keine klinisch relevanten Veränderungen der Pharmakokinetik von Selpercatinib beobachtet.
Verminderte Wirksamkeit von Selpercatinib möglich
Die gleichzeitige Einnahme mit einem H2-Rezeptorantagonisten kann die Wirksamkeit von Selpercatinib vermindern.
Die gleichzeitige Behandlung von Selpercatinib mit H2-Rezeptorantagonisten wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls muss Selpercatinib 2 h vor dem H2-Rezeptorantagonisten eingenommen werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Selpercatinib - Mässige CYP3A-Inhibitoren
Selpercatinib wird haupsächlich durch CYP3A abgebaut; mässige CYP3A-Inhibitoren können daher die Exposition von Selpercatinib erhöhen.
Verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mässigen CYP3A-Inhibitoren werden verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib erwartet (z.B. Hypertonie, Verlängerung der QT-Zeit und gastrointestinale Störungen).
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und mässigen CYP3A-Inhibitoren wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls soll die Dosierung von Selpercatinib von 120 mg 2mal täglich auf 80 mg 2mal täglich resp. von 160 mg 2mal täglich auf 120 mg 2mal täglich reduziert werden. Zudem soll das QT-Intervall häufiger kontrolliert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >60 ms bzw. >500 ms soll Selpercatinib abgesetzt werden. Nach Absetzten des Inhibitors muss mindestens 3 Halbwertszeiten abgewartet werden, bevor die Behandlung mit Selpercatinib in der normalen Dosierung weitergeführt werden kann.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Selpercatinib - Starke CYP3A-Inhibitoren
Selpercatinib wird haupsächlich durch CYP3A abgebaut; starke CYP3A-Inhibitoren können daher die Exposition von Selpercatinib erhöhen.
Verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit starken CYP3A-Inhibitoren werden verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib erwartet (z.B. Hypertonie, Verlängerung der QT-Zeit und gastrointestinale Störungen).
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und starken CYP3A-Inhibitoren wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls soll die Dosierung von Selpercatinib von 120 mg 2mal täglich auf 40 mg 2mal täglich resp. von 160 mg 2mal täglich auf 80 mg 2mal täglich reduziert werden. Zudem soll das QT-Intervall häufiger kontrolliert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von >60 ms bzw. >500 ms soll Selpercatinib abgesetzt werden. Nach Absetzten des Inhibitors muss mindestens 3 Halbwertszeiten abgewartet werden, bevor die Behandlung mit Selpercatinib in der normalen Dosierung weitergeführt werden kann.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Selpercatinib - QT-verlängernde mässige CYP3A-Inhibitoren
Selpercatinib wird haupsächlich durch CYP3A abgebaut; mässige CYP3A-Inhibitoren können daher die Exposition von Selpercatinib erhöhen. Zudem können sich die proarrhythmischen Wirkungen der genannten QT-Zeit verlängernden Substanzen und Selpercatinib addieren oder potenzieren.
Verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib möglich/erhöhtes Risiko von Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mässigen CYP3A-Inhibitoren werden verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib erwartet (z.B. Hypertonie, Verlängerung der QT-Zeit und gastrointestinale Störungen). Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, ist das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Torsades de pointes können mit Schwindel und Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und mässigen CYP3A-Inhibitoren wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls soll die Dosierung von Selpercatinib von 120 mg 2mal täglich auf 80 mg 2mal täglich resp. von 160 mg 2mal täglich auf 120 mg 2mal täglich reduziert werden. Zudem soll das QT-Intervall häufiger kontrolliert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von >60 ms bzw. >500 ms soll Selpercatinib abgesetzt werden. Nach Absetzten des Inhibitors muss mindestens 3 Halbwertszeiten abgewartet werden, bevor die Behandlung mit Selpercatinib in der normalen Dosierung weitergeführt werden kann.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Selpercatinib - QT-verlängernde starke CYP3A-Inhibitoren
Selpercatinib wird haupsächlich durch CYP3A abgebaut; starke CYP3A-Inhibitoren können daher die Exposition von Selpercatinib erhöhen. Zudem können sich die proarrhythmischen Wirkungen der genannten QT-Zeit verlängernden Substanzen und Selpercatinib addieren oder potenzieren.
Verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib möglich/erhöhtes Risiko von Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit starken CYP3A-Inhibitoren werden verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib erwartet (z.B. Hypertonie, Verlängerung der QT-Zeit und gastrointestinale Störungen). Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, ist das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Torsades de pointes können mit Schwindel und Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und starken CYP3A-Inhibitoren wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls soll die Dosierung von Selpercatinib von 120 mg 2mal täglich auf 40 mg 2mal täglich resp. von 160 mg 2mal täglich auf 80 mg 2mal täglich reduziert werden. Zudem soll das QT-Intervall häufiger kontrolliert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >60 ms bzw. >500 ms soll Selpercatinib abgesetzt werden. Nach Absetzten des Inhibitors muss mindestens 3 Halbwertszeiten abgewartet werden, bevor die Behandlung mit Selpercatinib in der normalen Dosierung weitergeführt werden kann.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Selpercatinib - Tucatinib
Selpercatinib wird haupsächlich durch CYP3A abgebaut; Tucatinib kann als starker CYP3A-Inhibitor daher die Exposition von Selpercatinib erhöhen. Umgekehrt kann Selpercatinib als mässiger CYP2C8-Inhibitor die Bioverfügbarkeit von Tucatinib erhöhen.
Verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib und Tucatinib möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Tucatinib werden verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib erwartet (z.B. Hypertonie, Verlängerung der QT-Zeit und gastrointestinale Störungen). Umgekehrt kann Selpercatinib möglicherweise die Wirkungen von Tucatinib verstärken.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und Tucatinib wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls soll die Dosierung von Selpercatinib von 120 mg 2mal täglich auf 40 mg 2mal täglich resp. von 160 mg 2mal täglich auf 80 mg 2mal täglich reduziert werden und auf verstärkte Wirkungen von Tucatinib geachtet werden. Zudem soll das QT-Intervall häufiger kontrolliert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von >60 ms bzw. >500 ms soll Selpercatinib abgesetzt werden. Nach Absetzten von Tucatinib muss mindestens 3 Halbwertszeiten (ca. 30 h) abgewartet werden, bevor die Behandlung mit Selpercatinib in der normalen Dosierung weitergeführt werden kann.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Substrate (CYP3A) - Selpercatinib
Selpercatinib ist ein schwacher CYP3A-Inhibitor und kann daher die Bioverfügbarkeit von CYP3A-Substraten erhöhen: Selpercatinib erhöhte die AUC von Midazolam um 54% und die Cmax um 39%.
Verstärkte Wirkungen der CYP3A-Substrate möglich
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib kann möglicherweise die Wirkungen von sensitiven CYP3A-Substraten verstärken.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und sensitiven CYP3A-Substraten wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls sollen die Patienten sorgfältig auf verstärkte Wirkungen des CYP3A-Substrats überwacht werden und ggf. eine Dosisanpassung vorgenommen werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Selpercatinib - Aprepitant
Sowohl Aprepitant als auch Selpercatinib sind CYP3A-Substrate, zudem ist Aprepitant ein mässiger und Selpercatinib ein schwacher CYP3A-Inhibitor. Eine gleichzeitige Behandlung kann sowohl die Exposition gegenüber Selpercatinib als auch gegenüber Aprepitant erhöhen.
Verstärkte unerwünschte Wirkungen von Selpercatinib und Aprepitant möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Selpercatinib und Aprepitant kann zu verstärkten unerwünschten Wirkungen beider Substanzen führen: Selpercatinib ( z.B. Hypertonie, Verlängerung des QT-Intervalls, Gastrointestinale Störungen), Aprepitant (z.B. Schluckauf, Dyspepsie, Fatigue, Erhöhung der ALAT, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen).
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und Aprepitant wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls soll die Dosierung von Selpercatinib von 120 mg 2mal täglich auf 80 mg 2mal täglich resp. von 160 mg 2mal täglich auf 120 mg 2mal täglich reduziert werden. Zudem soll das QT-Intervall häufiger kontrolliert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >60 ms bzw. >500 ms soll Selpercatinib abgesetzt werden. Nach Absetzten von Aprepitant muss mindestens 3 Halbwertszeiten abgewartet werden, bevor die Behandlung mit Selpercatinib in der normalen Dosierung weitergeführt werden kann.
Zudem können verstärkte Wirkungen von Aprepitant nicht ausgeschlossen werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
QT-verlängernde CYP3A-Substrate - Selpercatinib
Selpercatinib ist ein schwacher CYP3A-Inhibitor und kann daher die Bioverfügbarkeit von CYP3A-Substraten erhöhen. Zudem können sich die proarrhythmischen Wirkungen der genannten QT-Zeit verlängernden Substanzen und Selpercatinib addieren oder potenzieren.
Verstärkte Wirkungen der CYP3A-Substrate möglich/erhöhtes Risiko von Arrhytmien
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib kann möglicherweise die Wirkungen von sensitiven CYP3A-Substraten verstärken. Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, ist das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Torsades de pointes können mit Schwindel und Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Selpercatinib und sensitiven CYP3A-Substraten wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls sollen die Patienten sorgfältig auf verstärkte Wirkungen des CYP3A-Substrats überwacht werden und ggf. eine Dosisanpassung vorgenommen werden. Zudem soll das QT-Intervall häufiger kontrolliert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >60 ms bzw. >500 ms soll Selpercatinib abgesetzt werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Selpercatinib - Protonenpumpeninhibitoren
Die Erhöhung des Magen-pH-Wertes kann die Löslichkeit und damit die Absorption von Selpercatinib vermindern.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Selpercatinib und Omeprazol im nüchternen Zustand verringerte sich die Exposition gegenüber Selpercatinib um 69–88%.
Verminderte Wirksamkeit von Selpercatinib möglich
Die gleichzeitige Einnahme mit einem Protonenpumpeninhibitor kann die Wirksamkeit von Selpercatinib vermindern.
Die gleichzeitige Behandlung von Selpercatinib mit Protonenpumpeninhibitoren wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls muss Selpercatinib mit einer Mahlzeit eingenommen werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Levetiracetam - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Levetiracetam und weiteren QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Levetiracetam und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Levertiracetam ist bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Andere Fachinformationen können von dieser Empfehlung abweichen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Alpelisib - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen der genannten QT-Zeit verlängernden Substanzen und Alpelisib können sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung zweier QT-verlängernder Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Alpelisib soll eine gleichzeitige Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen mit Vorsicht erfolgen. Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Levofloxacin: Die Interaktion kann auch bei inhalativer Anwendung auftreten, da gelegentlich Plasmakonzentrationen wie nach peroraler Gabe vorkommen können.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Eliglustat - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Eliglustat und QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Eliglustat und weiteren QT-verlängernden Substanzen ist Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Pralsetinib - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Pralsetinib und QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Pralsetinib und weiteren QT-verlängernden Substanzen ist Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
BCRP-Substrate - Acalabrutinib
Acalabrutinib ist ein BCRP-Inhibitor und kann die Exposition gegenüber BCRP-Substraten erhöhen. Die Interaktion wurde nicht untersucht.
Verstärkte Wirkung von BCRP-Substraten möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit BCRP-Substraten und Acalabrutinib wird eine verstärkte Wirkung der BCRP-Substrate erwartet.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit BCRP-Substraten und Acalabrutinib ist Vorsicht geboten; Patienten sollen auf UAW der genannten Substrate überwacht werden.Oral verabreichte BCRP-Substrate mit geringer therapeutischer Breite sollten mindestens 6 h vor oder nach Acalabrutinib eingenommen werden.
Vorsichtshalber überwachen
MATE1-Substrate - Selpercatinib
Selpercatinib ist ein MATE1-Inhibitor und kann die Exposition gegenüber MATE1-Substraten erhöhen. Die Interaktion wurde nicht untersucht.
Verstärkte Wirkung von MATE1-Substraten möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit MATE1-Substraten und Selpercatinib wird eine verstärkte Wirkung der MATE1-Substrate erwartet.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit MATE1-Substraten und Selpercatinib ist Vorsicht geboten; Patienten sollen auf UAW der genannten Substrate überwacht werden.
Vorsichtshalber überwachen
BCRP-Substrate - Tepotinib
Tepotinib ist ein BCRP-Inhibitor und kann die Exposition gegenüber BCRP-Substraten erhöhen.
Verstärkte Wirkung von BCRP-Substraten möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit BCRP-Substraten und Tepotinib wird eine verstärkte Wirkung der BCRP-Substrate erwartet.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit BCRP-Substraten und Tepotinib ist Vorsicht geboten; Patienten sollen auf UAW der genannten Substrate überwacht werden.
Vorsichtshalber überwachen
Lisdexamfetamin - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Lisdexamfetamin und weiteren QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Lisdexamfetamin und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.Torsade de pointes können mit Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Bei der gleichzeitiger Behandlung mit Lisdexamfetamin und weiteren QT-verlängernden Substanzen ist Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Vorsichtshalber überwachen