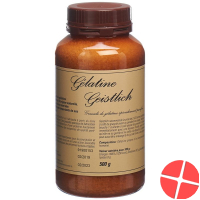Trimipramin Sandoz Tabletten 100mg 20 Stück buy online
Trimipramin Sandoz Tabl 100 mg 20 Stk
- Availability: In stock
- Brand: SANDOZ PHARMACEUT. AG
- Product Code: 3991592
- ATC-code N06AA06
- EAN 7680558350258
Ingredients:
Magnesium stearat, Lactose-1-Wasser 142.6 mg, Trimipramin 100 mg , Natrium 1.4 mg, Siliciumdioxid anhydrat, Povidon K25, Trimipramin maleat, Cellulose, mikrokristalline, Carboxymethylstärke, Natrium Typ A, PEG glycerol docosanoat.
Trimipramin 100 mg
Antidepressiva und MAO-Hemmer wirken synergistisch auf die Serotonin-Konzentration im ZNS und führen so wahrscheinlich zu einer Überstimulation von zentralen und peripheren Serotonin-Rezeptoren. Antidepressiva hemmen in unterschiedlichem Ausmass die Serotonin-Wiederaufnahme, MAO-Hemmer den Serotonin-Abbau durch die Monoaminoxidase A.
Auslösung eines Serotonin-Syndroms
Bei Kombination von tri-/tetrazyklischen Antidepressiva und den MAO-Hemmern Phenelzin, Tranylcypromin bzw. dem Zytostatikum Procarbazin, das ebenfalls ein schwacher, nicht-selektiver MAO-Hemmer ist, können nach kurzer Zeit (0,5 bis 48 h) die toxischen Symptome eines Serotonin-Syndroms auftreten. Symptome eines Serotonin-Syndroms: mentale (Verwirrtheit, Erregung, Agitiertheit, Unruhe), autonome (Schwitzen, Fieber, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckanstieg) und neuromuskuläre Störungen (Hyperreflexie, Krampfanfälle, Tremor). In schweren Fällen kann es zu Koma und Schock kommen.
MAO-Hemmer dürfen nicht mit tri-/tetrazyklischen Antidepressiva kombiniert werden. Aus Sicherheitsgründen sollen Antidepressiva erst 2 Wochen nach Absetzen von MAO-Hemmern angewandt werden. Bei der Umstellung von serotoninergen Antidepressiva auf MAO-Hemmer wird eine Auswaschphase empfohlen, deren Dauer von der Halbwertszeit des zuvor gegebenen Antidepressivums abhängt (z. B. Clomipramin, Nortriptylin: 14 Tage).
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - Droperidol, Pimozid, SertindolTri- bzw. tetrazyklische Antidepressiva haben ebenso wie Droperidol, Pimozid und Sertindol kardiotoxische, anticholinerge und zentraldämpfende Eigenschaften und senken die Krampfschwelle. Diese Effekte können sich dosisabhängig additiv verstärken. Darüber hinaus kann eine Hemmung des oxidativen Metabolismus beteiligt sein: Der Abbau der Antidepressiva und der Neuroleptika wird zum Teil durch CYP2D6 katalysiert. Durch Konkurrenz um das Enzym kann der Abbau beider Substanzen verlangsamt werden. Relevanz hat dies vor allem bei den 5 bis 10 % der Patienten, die langsame Metabolisierer von CYP2D6 sind. Die Plasmakonzentrationen werden dabei aber in sehr variablem Ausmass erhöht.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes) sowie weiteren Nebenwirkungen
Bei gleichzeitiger Behandlung mit tri- bzw. tetrazyklischen Antidepressiva und den genannten Neuroleptika ist das Risiko für ventrikuläre Tachykardien erhöht. Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen. Darüber hinaus können vermehrt anticholinerge (Mundtrockenheit, Akkommodations-, Miktionsstörungen, Obstipation) sowie zentraldämpfende Effekte vorkommen. Auch eine Absenkung der Krampfschwelle ist nicht auszuschliessen.
Die gleichzeitige Behandlung mit den genannten Antidepressiva und Droperidol, Pimozid oder Sertindol ist kontraindiziert.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - LumefantrinLumefantrin hemmt in vitro CYP2D6 und somit vermutlich auch den oxidativen Metabolismus der Antidepressiva. Ausserdem können sich die kardiotoxischen Effekte von Lumefantrin und den Antidepressiva additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Die gleichzeitige Behandlung mit Lumefantrin und Antidepressiva erhöht vermutlich das Risiko für QT-Zeit-Verlängerungen und Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen. In sehr seltenen Fällen können diese in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potentiell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Lumefantrin und Antidepressiva ist kontraindiziert.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Dapoxetin - Stoffe, die serotoninerg wirkenDer Schweregrad des Serotonin-Syndroms ist dosisabhängig. Dieser beruht auf einer Überstimulation der zentralen postsynaptischen Serotonin-Rezeptoren. Viele Wirkstoffe können durch verschiedene Mechanismen ein Serotonin-Syndrom induzieren: z.B. Erhöhung der Serotonin-Konzentration durch Hemmung der Wiederaufnahme aus dem synaptischen Spalt, Hemmung des Abbaus oder Erhöhung der Freisetzung.
Erhöhtes Risiko eines serotonergen Syndroms
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren serotoninergen Arzneistoffen, kann sich in seltenen Fällen ein Serotonin-Syndrom entwickeln. Symptome eines Serotonin-Syndroms umfassen: Verhaltensstörungen (Angst, Agitation, Verwirrtheit), autonome (Tachykardie, Hypertonie, Schwindel, Diaphorese, Flush, Hyperthermie, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen) und neuromuskuläre Störungen (Tremor, Rigidität, Myoklonien, Klonus, Hyperreflexie, Koordinationsstörungen). In schweren Fällen kann es zu Krampfanfällen, Rhabdomyolyse, akutem Nierenversagen, disseminierter intravasaler Koagulopathie, Koma und Schock mit potenziell letalem Ausgang kommen.
Dapoxetin darf nicht gleichzeitig mit den genannten serotoninerg wirkenden Arzneimitteln angewandt werden. Auch die Anwendung von Dapoxetin innerhalb von 14 Tagen nach Absetzen von serotoninergen Arzneimitteln ist kontraindiziert. Nach Absetzen von Dapoxetin sollen 7 Tage lang keine serotoninergen Arzneimittel angewandt werden.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Alpha-2-Rezeptoragonisten (okuläre, dermale Anwendung) - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeTri- und tetrazyklische Antidepressiva beeinflussen die noradrenerge Neurotransmission bzw. den Katecholamin-Stoffwechsel und können dadurch die Wirkung von okulär oder kutan angewendeten Alpha-2-Rezeptoragonisten beeinflussen. Der genaue Mechanismus der Interaktion bei okulär oder kutan angewendeten Alpha-2-Rezeptoragonisten ist nicht geklärt.
Beeinträchtigte Wirksamkeit möglich
Es wird befürchtet, dass tri- und tetrazyklische Antidepressiva die okuläre und kutane Wirkungen der Alpha-2-Rezeptoragonisten beeinträchtigen könnten.
Die gleichzeitige Anwendung von tri- oder tetrazyklischen Antidepressiva und okulär oder kutan angewendeten Alpha-2-Rezeptoragonisten ist nach Herstellerangaben kontraindiziert.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Thioridazin - Antidepressiva, trizyklischeDie Hemmung von CYP2D6 erhöht die Plasmakonzentrationen von Thioridazin. Das Phenothiazin-Neuroleptikum kann dosis- bzw. konzentrationsabhängig das QT-Intervall verlängern und ventrikuläre Tachykardien vom Torsade-de-pointes-Typ hervorrufen. Einige der genannten CYP2D6-Hemmer beeinträchtigen ebenfalls die kardiale Erregungsleitung und verlängern die QT-Zeit.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Trizyklische Antidepressiva, die CYP2D6 hemmen, können die Wirkungen von Thioridazin verstärken. Das Risiko von schwerwiegenden und potentiell tödlichen Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes (TdP) ist erhöht.
Die gleichzeitige Behandlung mit Thioridazin und den genannten CYP2D6-Inhibitoren ist kontraindiziert. Nach Absetzen von Thioridazin sollen 14 Tage bis zum Beginn der Behandlung mit einem CYP2D6-Inhibitor abgewartet werden. Nach Absetzen eines der betroffenen CYP2D6-Inhibitoren muss je nach Pharmakokinetik und Halbwertszeit einige Tage bis zum Beginn einer Behandlung mit Thioridazin abgewartet werden.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Antidepressiva, trizyklische - Johanniskrautextrakt, hyperforinarmSowohl die betroffenen trizyklischen Antidepressiva als auch Johanniskraut hemmen die Wiederaufnahme von Serotonin, so dass es zu einer Überstimulation der zentralen postsynaptischen Serotonin-Rezeptoren führen kann. Der Schweregrad des Serotonin-Syndroms ist dosisabhängig.
Erhöhtes Risiko von Serotonin-Syndrom
Bei gleichzeitiger Behandlung mit den betroffenen trizyklischen Antidepressiva und Johanniskraut kann sich in seltenen Fällen ein Serotonin-Syndrom entwickeln. Symptome eines Serotonin-Syndroms umfassen: Verhaltensstörungen (Angst, Agitation, Verwirrtheit), autonome (Tachykardie, Hypertonie, Schwindel, Diaphorese, Flush, Hyperthermie, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen) und neuromuskuläre Störungen (Tremor, Rigidität, Myoklonien, Klonus, Hyperreflexie, Koordinationsstörungen). In schweren Fällen kann es zu Krampfanfällen, Rhabdomyolyse, akutem Nierenversagen, disseminierter intravasaler Koagulopathie, Koma und Schock mit potenziell letalem Ausgang kommen.
Die gleichzeitige Behandlung mit den betroffenen trizyklischen Antidepressiva und Johanniskraut ist kontraindiziert.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Antidepressiva - Alkoholhaltige ArzneimittelAntidepressiva und Ethanol wirken zusammen verstärkt zentraldämpfend. Die sedierende Wirkung der Antidepressiva ist unterschiedlich ausgeprägt: Eher stark sedierend wirken Amitriptylin, Trimipramin, Doxepin, Dosulepin, eher gering sedierend Mianserin und Clomipramin. Darüber hinaus hemmt akuter Alkoholgenuss offenbar den First-pass-Metabolismus der trizyklischen Antidepressiva. Bei Alkoholabhängigkeit kann dagegen die Clearance einiger Antidepressiva beschleunigt sein. Reboxetin verstärkt die Wirkungen von Alkohol auf die kognitiven Funktionen bei gesunden Probanden nicht.
Verstärkte zentraldämpfende Wirkungen
Alkohol - auch in Arzneimitteln - kann während einer Behandlung mit Antidepressiva die zentraldämpfenden Effekte verstärken. Die Konzentrationsfähigkeit (z. B. im Strassenverkehr) wird beeinträchtigt. Auch orthostatischer Blutdruckabfall und mehrstündige Amnesien wurden schon nach dem Konsum geringer Alkoholmengen berichtet.
Patienten unter Antidepressiva sollen Alkohol - auch in Arzneimitteln - weitestgehend meiden. Eine alkoholfreie Alternative für das alkoholhaltige Arzneimittel ist zu erwägen. Patienten sollen nachdrücklich auf die verstärkte Konzentrationsbeeinträchtigung durch schon geringe Alkoholmengen aufmerksam gemacht werden. Auch bei Antidepressiva, die in Studien keine verstärkten zentraldämpfenden Effekte bei Alkoholzufuhr zeigten, soll Alkohol aus grundsätzlichen Erwägungen gemieden werden. Alkohol kann den Verlauf von psychischen Krankheiten beeinflussen; auch aus diesem Grund sollen psychiatrische Patienten Alkohol möglichst meiden. Bei akuter Alkoholintoxikation sind Antidepressiva kontraindiziert.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Antiarrhythmika - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben. Bei Antiarrhythmika beträgt die Inzidenz etwa 1:100 bis 4:100.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können wie bestimmte Antiarrhythmika und Antidepressiva, sind vermehrt ventrikuläre Tachykardien zu befürchten. Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit den genannten Antiarrhythmika und Antidepressiva ist kontraindiziert; Alternativarzneimittel sind zu bevorzugen. Ist sie dennoch unumgänglich, soll sie unter sorgfältigster elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 60 ms bzw. auf über etwa 460-500 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Clozapin - Agranulozytose-induzierende StoffeVon einer additiven Wirkung auf das Knochenmark ist auszugehen. Eine retrospektive Studie in Finnland zeigte, dass ca. 40 % aller Patienten, die unter Clozapin eine Agranulozytose entwickelten, weitere Arzneistoffe erhielten, die Agranulozytosen auslösen können. Stoffe mit dieser Nebenwirkung sind nur schwer zu benennen, da meist nur Fallberichte vorliegen. Es handelt sich um sehr viele Stoffe aus sehr unterschiedlichen Stoffgruppen.
Erhöhung des Risikos und/oder der Schwere von Granulozytopenien/Agranulozytosen
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Clozapin und weiteren Arzneistoffen, die Agranulozytosen hervorrufen können, ist eine erhöhte Inzidenz und Schwere von Granulozytopenien und Agranulozytosen zu befürchten. Eine Agranulozytose tritt meist zu Beginn der Behandlung mit Clozapin auf, kann aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt ausgelöst werden (siehe Kommentar).
Den Produktinformationen von Clozapin zufolge darf eine Therapie mit diesem Neuroleptikum nicht eingeleitet werden, wenn der Patient bereits mit einem Arzneistoff behandelt wird, von dem bekannt ist, dass er ein erhebliches Potenzial hat eine Agranulozytose hervorzurufen (Kontraindikation). Agranulozytosen sind eine schwere, aber seltene Nebenwirkung vieler lebenswichtiger Arzneistoffe. Daher können Fälle eintreten, in denen die gleichzeitige Behandlung mit Clozapin und einem dieser Arzneistoffe unumgänglich wird. In einem solchen Fall muss das Blutbild besonders engmaschig überwacht werden. Bei alleiniger Therapie mit Clozapin sind die Leukozyten und neutrophilen Granulozyten während der ersten 18 Wochen wöchentlich und danach während der gesamten Behandlung mindestens alle 4 Wochen zu kontrollieren. Auch bei lokaler Anwendung von Chloramphenicol am Auge wurden hämatotoxische Effekte beobachtet, so dass auch diese Darreichungsformen kontraindiziert sind.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Antidepressiva, serotoninerge - Moclobemid (reversibler MAO-A-Hemmer)Das Serotonin-Syndrom beruht auf einer Überstimulation von zentralen und peripheren Serotonin-Rezeptoren; meist tritt es wenige Stunden oder Tage nach Beginn der gleichzeitigen Anwendung mehrerer serotoninerger Arzneimittel auf. Nach Absetzen der auslösenden Arzneimittel bildet sich das Serotonin-Syndrom in der Regel innerhalb von 24 h zurück. Serotonin-Reuptake-Hemmer verstärken die serotoninerge Übertragung durch Hemmung der Wiederaufnahme von Serotonin aus dem synaptischen Spalt. MAO-Hemmer erhöhen die Verfügbarkeit von Serotonin, indem sie den Abbau von Serotonin durch die Monoaminooxidasen (MAO), vorwiegend durch MAO-A und in geringem Ausmass auch MAO-B, hemmen.
Auslösung eines Serotonin-Syndroms möglich
Bei Kombination von Moclobemid mit serotoninerg wirkenden Antidepressiva wurden in Einzelfällen schwere Serotonin-Syndrome berichtet. Symptome eines Serotonin-Syndroms: mentale (Verwirrtheit, Erregung, Agitiertheit, Unruhe), autonome (Schwitzen, Fieber, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckanstieg) und neuromuskuläre Störungen (Hyperreflexie, Krampfanfälle, Tremor). In schweren Fällen kann es zu Koma und Schock kommen. Absichtliche oder akzidentelle Überdosierung der Antidepressiva spielte in den meisten berichteten Fällen eine Rolle.
Die Kombination von Moclobemid mit serotoninerg wirkenden Antidepressiva ist kontraindiziert. Bei einer Umstellung kann die Behandlung mit trizyklischen oder anderen serotoninerg wirkenden Antidepressiva 24 h nach Absetzen von Moclobemid begonnen werden. Bei der Umstellung von serotoninergen Antidepressiva auf Moclobemid wird eine Auswaschphase empfohlen, deren Dauer von der Halbwertszeit des zuvor gegebenen Antidepressivums abhängt (Clomipramin, Nortriptylin: 14 Tage, Venlafaxin: 7 Tage).
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Antidepressiva, serotoninerge - LinezolidDas Serotonin-Syndrom beruht auf einer Überstimulation zentraler und peripherer Serotonin-Rezeptoren und tritt meist bei Anwendung mehrerer serotoninerger Arzneimittel auf. Das Oxazolidinon-Antibiotikum Linezolid ist ein reversibler, nicht-selektiver Monoaminoxidase-Hemmer, der den Abbau von Serotonin hemmen kann, während serotoninerge Antidepressiva dessen Wiederaufnahme aus dem synaptischen Spalt hemmen bzw. direkt serotoninagonistisch wirken.
Provokation eines Serotonin-Syndroms möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Linezolid und serotoninergen Antidepressiva wurden in mehreren Fällen Symptome eines Serotonin-Syndroms beobachtet. Symptome eines Serotonin-Syndroms: mentale (Verwirrtheit, Erregung, Agitiertheit, Unruhe), autonome (Schwitzen, Fieber, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckanstieg) und neuromuskuläre Störungen (Hyperreflexie, Krampfanfälle, Tremor). In schweren Fällen kann es zu Koma und Schock kommen. Die Symptome traten in der Regel nach kurzer Dauer (0,5 bis 48 h) der gleichzeitigen Behandlung auf; vor allem bei älteren Patienten trat das Serotonin-Syndrom auch mit Verzögerung von einigen Tagen auf.
Die gleichzeitige Behandlung mit dem Oxazolidin-Antibiotikum Linezolid und serotoninergen Antidepressiva ist kontraindiziert. Ist während der Therapie mit einem Serotonin-Reuptake-Hemmer die sofortige Gabe des Antibiotikums unumgänglich, sollen die Patienten während der antibiotischen Behandlung sorgfältig auf Zeichen eines Serotonin-Syndroms beobachtet werden; das Absetzen des Serotonin-Reuptake-Hemmers soll erwogen werden.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Antidepressiva, trizyklische - Serotonin-Reuptake-HemmerDie genannten trizyklischen Antidepressiva und Citalopram/Escitalopram verlängern additiv die QT-Zeit im EKG. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben. Die kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken und sind dosisabhängig. Die meisten der betroffenen Patienten weisen einen oder mehrere der unten genannten Risikofaktoren auf. Zusätzlich können pharmakokinetische Effekte eine Rolle spielen.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren torsadogenen Arzneistoffen wie trizyklischen Antidepressiva und Citalopram/Escitalopram sind vermehrt QT-Zeit-Verlängerungen und ventrikuläre Tachykardien zu befürchten. Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen. Torsade de pointes treten eher selten in den ersten 3 Tagen einer Behandlung auf; häufiger kommen sie nach 3 bis 30 Tagen oder noch später vor.
Die gleichzeitige Behandlung mit Citalopram bzw. Escitalopram und weiteren QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen ist laut Herstellerangaben kontraindiziert. Ist die gleichzeitige Behandlung dennoch unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50 ms bzw. auf über etwa 460 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) soll das Serum-Kalium überwacht werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Saquinavir - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben. Bei Antiarrhythmika beträgt die Inzidenz etwa 1:100 bis 4:100. Hinzu kommen teilweise pharmakokinetische Interaktionen mit Plasmakonzentrationserhöhungen der Arzneistoffe.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Saquinavir und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, sind vermehrt ventrikuläre Tachykardien zu befürchten. Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Saquinavir und den genannten QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen ist kontraindiziert. Ist sie unumgänglich, soll sie unter sorgfältigster elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50-60 ms bzw. auf über 460-500 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Chinin - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben. Bei Antiarrhythmika beträgt die Inzidenz etwa 1:100 bis 4:100. Hinzu kommen teilweise pharmakokinetische Interaktionen mit Plasmakonzentrationserhöhungen der Arzneistoffe.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Chinin und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, sind vermehrt ventrikuläre Tachykardien zu befürchten. Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Chinin und allen genannten QT-Zeit-verlängernden Arzneistoffen ist kontraindiziert.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Efavirenz - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben. Bei Antiarrhythmika beträgt die Inzidenz etwa 1:100 bis 4:100. Hinzu kommen teilweise pharmakokinetische Interaktionen mit Plasmakonzentrationserhöhungen der Arzneistoffe.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Efavirenz und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, sind vermehrt ventrikuläre Tachykardien zu befürchten. Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Efavirenz und den genannten QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen ist kontraindiziert. Ist sie unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der herzfrequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50-60 ms bzw. auf 460-500 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) wird empfohlen, den Elektrolytstatus und besonders das Serum-Kalium zu überwachen. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Pseudoephedrin - Antidepressiva, trizyklischePseudoephedrin setzt Noradrenalin aus noradrenergen Neuronen frei. In Gegenwart von Antidepressiva ist die Wiederaufnahme von Noradrenalin in die Speicher vermindert, so dass dieser Wirkungsmechanismus nicht mehr greift. Somit ist theoretisch initial eine verstärkte, dann aber eine abgeschwächte sympathomimetische Wirkung zu erwarten.
Erst verstärkte, dann abgeschwächte sympathomimetische Wirkung
Die sympathomimetische Wirkung von Pseudoephedrin kann durch trizyklische Antidepressiva verstärkt (Blutdruckanstieg, Tachykardie), später eventuell abgeschwächt werden.
Die gleichzeitige Behandlung mit Pseudoephedrin und trizyklischen Antidepressiva wird nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Morclofon - Zentraldämpfende StoffeMorclofon besitzt einen selektiven antitussiven Effekt, der über einen zentralen Wirkungsmechanismus zustande kommt. Man geht davon aus, dass es bei gleichzeitigir Behandlung mit zentral dämpfenden Substanzen zu einer Wirkungsverstärkung kommen kann.
Erhöhtes Risiko für zentraldämpfende Wirkungen
Bei gleichzeitiger Behandlung mit zentral dämpfenden Substanzen werden vermehrt zentral dämpfende Wirkungen befürchtet.
Die gleichzeitige Behandlung mit zentraldämpfenden Arzneimittel soll vermieden werden.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Entrectinib - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie QT-verlängernden Substanzen wurden in Zusammenhang mit einem Risiko für Torsade de pointes gebracht; Entrectinib hat in den klinischen Studien zu einer Verlängerung der QT-Zeit geführt. Die proarrhythmischen Wirkungen von Entrectinib und den QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Torsade de pointes
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Entrectinib und QT-verlängernden Substanzen werden verstärkt Arrhythmien, insbesondere Torsade de pointes, befürchtet.
Die gleichzeitige Behandlung mit Entrectinib und den genannten QT-verlängernden Substanzen ist nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
QT-Zeit verlängernde Substanzen - DegarelixDie Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben. Die kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken und sind dosisabhängig.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien
Eine Androgen-Entzugstherapie kann das QT-Intervall verlängern. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln, die ebenfalls das QT-Intervall verlängern können, ist daher das Risiko für ventrikuläre Tachykardien erhöht. Torsade de pointes mit Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung von Degarelix und Wirkstoffen welche das QT-Intervall verlängern wird nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Alpha-2-Rezeptoragonisten - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeDer Mechanismus der verminderten Blutdrucksenkung sowie der hypertensiven Krise ist nicht vollständig geklärt. Antidepressiva (tri- und tetrazyklische) hemmen die Wiederaufnahme von Katecholaminen, wodurch diese vermehrt zirkulieren. Dadurch kann der blutdrucksenkende Effekt von Alpha-2-Rezeptoragonisten vermindert sein und sich der Entzugshochdruck nach Absetzen von Alpha-2-Rezeptoragonisten verstärken.
Verminderte blutdrucksenkende Wirkung - Blutdruckanstieg/verstärkter Entzugshochdruck
Antidepressiva (tri- und tetrazyklische) können die blutdrucksenkende Wirkung von systemisch angewandten Alpha-2-Rezeptoragonisten stark abschwächen oder aufheben. In Einzelfällen sind während einer Behandlung mit Alpha-2-Rezeptoragonisten einige Tage bis 2 Wochen nach Beginn einer Antidepressiva-Therapie hypertensive Krisen mit Kopfschmerzen, Schwindel, Dyspnoe, Herzklopfen, Nasenbluten und Tinnitus aufgetreten. Das abrupte Absetzen von Alpha-2-Rezeptoragonisten während einer Behandlung mit Antidepressiva kann einen verstärkten Entzugshochdruck zur Folge haben.
Die gleichzeitige Behandlung mit tri-/tetrazyklischen Antidepressiva und Alpha-2-Rezeptoragonisten wird nicht empfohlen. Ist die gleichzeitige Behandlung dennoch nötig, muss der Blutdruck genau überwacht und bei Bedarf die Dosis systemisch angewandter Alpha-2-Rezeptoragonisten erhöht werden. Nach dem Absetzen des Antidepressivums muss eine erhöhte Dosis wieder gesenkt werden. Alternative Antihypertonika können erwogen werden; bei den Antidepressiva scheint Bupropion in geringerem Ausmass zu interagieren. Um einen Entzugshochdruck zu vermeiden, muss das Absetzen von Alpha-2-Rezeptoragonisten immer, auch nach alleiniger Therapie, langsam und stufenweise vorgenommen werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Sympathomimetika - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeDie Antidepressiva hemmen die Inaktivierung der endogenen Katecholamine durch Hemmung der aktiven Wiederaufnahme in die präsynaptischen Speicher.
Starker Blutdruckanstieg, Herzrhythmusstörungen möglich
Die Wirkungen von Sympathomimetika (Dopamin, Epinephrin, Norepinephrin, Phenylephrin, Midodrin) können durch die genannten Antidepressiva erheblich verstärkt werden. Herzfrequenz- und Blutdruckanstiege bis hin zu Hochdruckkrisen mit Kopfschmerzen, Sehstörungen und Verwirrtheit können auftreten.
Die gleichzeitige systemische Behandlung mit den genannten Sympathomimetika und Antidepressiva soll möglichst vermieden werden. Ist sie unvermeidbar, sollen kleine Dosen des Sympathomimetikums mit grosser Vorsicht unter Blutdruckkontrolle gegeben werden. Auch Sympathomimetika als vasokonstriktorische Zusätze in Lokalanästhetika interagieren; als alternativer Vasokonstriktor bei einer Lokalanästhesie können Vasopressin-Analoge (z. B. Felypressin) eingesetzt werden. Als alternative Antidepressiva kommen Mianserin und Trazodon in Frage, für die diese Wechselwirkung nicht gefunden wurde.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - Serotonin-Reuptake-HemmerPharmakodynamische und pharmakokinetische Effekte können eine Rolle spielen: Die Serotonin-Reuptake-Hemmer hemmen CYP2D6 (Fluoxetin, Paroxetin) bzw. CYP1A2 und CYP2C19 (Fluvoxamin), die den oxidativen Metabolismus der Antidepressiva katalysieren. Sertralin hemmt CYP2D6 in geringerem Ausmass. Darüber hinaus können sich die serotoninergen und die QT-Zeit-verlängernden Effekte der beiden Stoffgruppen dosisabhängig additiv verstärken.
Verstärkte Wirkungen der Antidepressiva
Die Kombination mit Serotonin-Reuptake-Hemmern kann die therapeutischen und die unerwünschten Wirkungen von tri- und tetrazyklischen Antidepressiva verstärken. Anticholinerge Effekte, Sedation, Konfusion, Herzrhythmusstörungen und QT-Zeit-Verlängerungen können verstärkt und vermehrt auftreten. In Einzelfällen kann ein Serotonin-Syndrom auftreten; dieses ist gekennzeichnet durch mentale (Verwirrtheit, Erregung, Angst), autonome (Schwitzen, Hyperthermie, Diarrhoe, Übelkeit, Blutdruckschwankungen) und neuromuskuläre Störungen (Hyperreflexie, Tremor, Nystagmus). Ausserdem wurde bei älteren Patienten unter Behandlung mit der Kombination eine erhöhte Inzidenz von Knochenbrüchen beobachtet.
Bei einer Kombinationstherapie mit Serotonin-Reuptake-Hemmern empfiehlt es sich, auf vermehrte bzw. verstärkte unerwünschte Effekte zu achten und die Dosis des Antidepressivums nach Bedarf zu verringern. Vor allem, wenn Risikofaktoren vorliegen, sollen die Patienten elektrokardiographisch überwacht werden. Bei Anzeichen für ein Serotonin-Syndrom sollen die Arzneistoffe abgesetzt werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - Antibiotika, QT-Zeit-verlängernde (Makrolide)Die kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken und sind dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben. Die meisten der betroffenen Patienten weisen einen oder mehrere der genannten Risikofaktoren auf. Einige der betroffenen Antibiotika wie Clarithromycin, Erythromycin und Telithromycin hemmen auch Cytochrom-P-450-abhängige Enzyme, die den oxidativen Metabolismus der Antidepressiva katalysieren können. Erhöhte Plasmakonzentrationen der Antidepressiva erhöhen das Risiko von QT-Zeit-Verlängerungen und Torsade de pointes. Bei gesunden Probanden erhöhte die gleichzeitige Gabe von Clarithromycin die Bioverfügbarkeit von Trazodon im Schnitt auf fast das Doppelte.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, wie einige Antibiotika und Antidepressiva, steigt das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes. Symptomatische Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle können auftreten. Meist enden Torsade de pointes spontan; sehr selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit den genannten Antidepressiva und weiteren QT-Zeit-verlängernden Arzneistoffen soll möglichst vermieden werden; Alternativarzneimittel sind zu bevorzugen. Ist sie nötig, soll sie in niedrigst wirksamer Dosis sowie unter sorgfältiger EKG-Überwachung vorgenommen werden. Elektrolytstörungen und Bradykardien sollen vor der Anwendung korrigiert werden. Der Elektrolytstatus ist ebenfalls zu überwachen. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50 ms bzw. auf über etwa 460 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - H1-Blocker (Antiallergika)Antidepressiva und H1-Blocker verlängern additiv und dosisabhängig die QT-Zeit im EKG. Die meisten der betroffenen Patienten weisen einen oder mehrere Risikofaktoren auf. Die verstärkten anticholinergen Wirkungen beruhen auf additiven peripheren und zentralen Wirkungen der Arzneistoffe. Unter den trizyklischen Antidepressiva wirken besonders Amitriptylin, Imipramin, Trimipramin und Nortriptylin stark anticholinerg.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien, verstärkte anticholinerge Wirkungen
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-Zeit-verlängernden Arzneistoffen wie Antidepressiva und einigen H1-Blockern ist das Risiko für ventrikuläre Tachykardien und Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Symptome sind Herzklopfen, Benommenheit, Schwindel und Ohnmachtsanfälle. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen. Torsade de pointes treten selten in den ersten 3 Tagen einer Behandlung auf; häufiger kommen sie nach 3 bis 30 Tagen oder später vor. Auch anticholinerge Effekte können vermehrt und verstärkt auftreten: Akkommodationsstörungen, Mydriasis, Mundtrockenheit, Obstipation, Tachykardie, Miktionsstörungen, Schweissminderung. Vor allem bei älteren Patienten können delirante Syndrome mit Verwirrtheit, Halluzinationen und Erregungszuständen sowie kognitive Störungen vorkommen und das Sturzrisiko kann erhöht sein.
Die gleichzeitige Behandlung mit mehreren QT-Zeit-verlängernden Arzneistoffen ist möglichst zu vermeiden, besonders bei Patienten mit Risikofaktoren. Ist die gleichzeitige Behandlung unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit um mehr als 50 ms bzw. auf mehr als 460-500 ms (unterschiedl. Grenzwerte werden genannt) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) soll das Serum-Kalium überwacht werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Herzklopfen, Benommenheit, Schwindel oder Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden. Auch im Hinblick auf periphere und zentrale anticholinerge Effekte soll sorgfältig überwacht werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - ProtozoenmittelDie genannten Antidepressiva und Protozoenmittel verlängern additiv die QT-Zeit im EKG. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben. Die kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken und sind dosisabhängig. Die meisten der betroffenen Patienten weisen einen oder mehrere der unten genannten Risikofaktoren auf.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren torsadogenen Arzneistoffen wie bestimmte Antidepressiva und einigen Protozoenmitteln (teilweise auch in anderen Indikationen verwendet) sind vermehrt QT-Zeit-Verlängerungen und ventrikuläre Tachykardien zu befürchten. Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen. Torsade de pointes treten eher selten in den ersten 3 Tagen einer Behandlung auf; häufiger kommen sie nach 3 bis 30 Tagen oder noch später vor.
Die gleichzeitige Behandlung mit mehreren QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen ist möglichst zu vermeiden, ganz besonders bei Patienten mit Risikofaktoren. Ist sie unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Elektrolytstörungen und Bradykardien sollen vor der Anwendung korrigiert werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit um mehr als 60 ms bzw. auf über etwa 460-500 ms sollen die Risiko-Arzneimittel abgesetzt werden. Die Patienten sollen über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
QT-Zeit verlängernde Substanzen - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, steigt die Inzidenz von Rhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes. Symptome sind Herzklopfen, Benommenheit, Schwindel und Ohnmachtsanfälle. In sehr seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit mehreren QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen soll möglichst vermieden werden. Ist sie unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit um mehr als 50 ms bzw. auf mehr als 460-500 ms (unterschiedl. Grenzwerte werden genannt) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) wird empfohlen, das Serum-Kalium zu überwachen. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Herzklopfen, Benommenheit, Schwindel oder Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - BupropionSowohl Bupropion als auch tri- und tetrazyklische Antidepressiva können dosisabhängig die Krampfschwelle herabsetzen. Die Häufigkeit von zentralen Krampfanfällen während einer Behandlung mit therapeutischen Dosen von Antidepressiva wird mit etwa 1% angegeben. Zusätzlich können Bupropion und dessen Metaboliten den oxidativen Metabolismus der Antidepressiva durch CYP2D6 hemmen, so dass erhöhte Plasmakonzentrationen auftreten; der hemmende Effekt auf CYP2D6 hält ca. 7 Tage nach dem Absetzen von Bupropion an.
Erhöhtes Risiko von Krampfanfällen
Die gleichzeitige Behandlung mit dem Antidepressivum und Raucherentwöhnungsmittel Bupropion kann die Toxizität von tri- und tetrazyklischen Antidepressiva erhöhen. Vor allem eine erhöhte Inzidenz von Krampfanfällen wird befürchtet. Aber auch andere unerwünschte Wirkungen der Antidepressiva wie anticholinerge (Mundtrockenheit, Akkommodations-, Miktionsstörungen, Obstipation) und zentrale Effekte (Lethargie, Konfusion) können vermehrt bzw. verstärkt auftreten.
Bupropion ist bei Patienten mit Krampfanfällen in der Anamnese kontraindiziert. Bei Patienten mit prädisponierenden Faktoren für eine Erniedrigung der Krampfschwelle ist daher Vorsicht geboten; tri- und tetrazyklische Antidepressiva sollen möglichst vermieden werden. Werden die Arzneistoffe dennoch gleichzeitig eingesetzt, sollen möglichst niedrige Dosierungen der Antidepressiva bzw. von Bupropion gewählt werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Methadon, Levomethadon - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosis- bzw. konzentrationsabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können wie Levo-/Methadon und einigen Antidepressiva, ist das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Symptomatische Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle können auftreten. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit mehreren QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen soll möglichst vermieden werden. Ist sie unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der herzfrequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50-60 ms bzw. auf 460-500 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Der Nutzen einer Substitutionsbehandlung mit Methadon soll generell sorgfältig gegen das Tachykardierisiko abgewogen werden. Vor Therapieeinleitung und nach zwei Behandlungswochen soll ein EKG abgeleitet werden, um eventuelle QT-Zeit-Verlängerungen zu quantifizieren. In gleicher Weise sollen bei einer Dosis-Erhöhung EKGs angefertigt werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische - FluconazolDie erhöhten Plasmakonzentrationen der trizyklischen Antidepressiva beruhen vermutlich auf einer Hemmung ihres oxidativen Metabolismus. Das Risiko von Torsade de pointes wird möglicherweise durch eine eigene QT-Zeit-verlängernde Wirkung von Fluconazol weiter erhöht.
Verstärkte Wirkungen der Antidepressiva/erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien
Bei gleichzeitiger Behandlung mit trizyklischen Antidepressiva und Fluconazol kann es zu verstärkten Wirkungen der Antidepressiva kommen. Mehrere Einzelfälle beschreiben erhöhte Amitriptylin-Plasmakonzentrationen mit QT-Zeit-Verlängerungen, Torsade de pointes und Bewusstseinsverlust sowie Halluzinationen und Delirium. In einem Fall wurden bei gleichzeitiger Behandlung mit Fluconazol erhöhte Nortriptylin-Plasmakonzentrationen mit Sedation festgestellt.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Fluconazol und trizyklischen Antidepressiva sollen die Patienten sorgfältig elektrokardiogaphisch sowie auf die genannten unerwünschten Effekte überwacht und bei Bedarf Dosisanpassungen vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit um mehr als 60 ms bzw. auf über etwa 460-500 ms sollen die Risiko-Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) wird empfohlen, das Serum-Kalium zu überwachen. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Aminopyridine - Stoffe, die die Krampfschwelle senkenDie Interaktion beruht auf einem additiven Effekt der betroffenen Arzneimittel auf die Krampfschwelle.
Erhöhtes Risiko von Krampfanfällen
Die gleichzeitige Behandlung mit den Aminopyridin-Derivaten Fampridin und Amifampridin und weiteren Arzneimitteln, die die Krampfschwelle senken (Neuroleptika, Antidepressiva, Antimalariamittel, Atomoxetin, Tramadol, Theophyllin, systemische Glukokortikoide, Chinolone, sedierenden Antihistaminika, Stimulantien, Appetitzügler) kann das Risiko von Krampfanfällen erhöhen.
Die Entscheidung, gleichzeitig mit Aminopyridin-Derivaten Arzneistoffe anzuwenden, die die Krampfschwelle senken, soll sorgfältig abgewogen werden. Wenn ein Krampfanfall auftritt, ist die Behandlung abzubrechen. Levofloxacin: Die Interaktion kann auch bei inhalativer Anwendung auftreten, da gelegentlich Plasmakonzentrationen wie nach peroraler Gabe vorkommen können.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Tramadol - Antidepressiva, trizyklischeAdditive Effekte: Tramadol setzt dosisabhängig die Krampfschwelle herab. Auch trizyklische Antidepressiva können die Krampfschwelle senken; sehr selten (unter 0,1 Promille) können Krampfanfälle auftreten. Tramadol hat ausserdem ebenso wie die trizyklischen Antidepressiva serotoninerge Effekte, so dass additive Wirkungen auf die Serotonin-Konzentration im ZNS auslösend für ein Serotonin-Syndrom sein können. Darüber hinaus ist denkbar, dass entsprechende Antidepressiva den oxidativen Metabolismus von Tramadol durch CYP2D6 hemmen und so dessen Plasmakonzentration erhöhen.
Erhöhte Gefahr von Krampfanfällen und eines Serotonin-Syndroms
Tramadol kann selten (0,1-1 Promille) Krampfanfälle auslösen. Die gleichzeitige Behandlung mit trizyklischen Antidepressiva kann das Risiko von Krampfanfällen erhöhen. Ausserdem ist die Gefahr eines Serotonin-Syndroms erhöht (Verwirrtheit, Erregung, Angst, Schwitzen, Hyperthermie, Diarrhoe, Übelkeit, Blutdruckschwankungen, Hyperreflexie, Tremor, Ataxie, Myoklonien, Nystagmus).
Der gleichzeitige Einsatz von Tramadol mit trizyklischen Antdepressiva soll individuell unter Einbeziehung weiterer Risikofaktoren (siehe Kommentar) abgewogen werden. Die Patienten sollen ausserdem sorgfältig über die Zeichen des Serotonin-Syndroms informiert werden. Die Dosierungsempfehlungen sollen nicht überschritten werden. Tramadol darf nicht eingesetzt werden bei Patienten, deren Epilepsie nicht ausreichend kontrolliert ist.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - NeuroleptikaSowohl Antidepressiva als auch Neuroleptika haben kardiotoxische, anticholinerge und zentraldämpfende Nebenwirkungen und senken die Krampfschwelle. Diese Effekte können sich dosisabhängig additiv verstärken. Darüber hinaus kann eine Hemmung des oxidativen Metabolismus beteiligt sein: Der Abbau von Antidepressiva und Neuroleptika wird zum Teil durch CYP2D6 katalysiert. Die Konkurrenz um das Enzym kann den Abbau beider Substanzen verlangsamen. Relevanz hat dies vor allem bei den 5 bis 10 % der Patienten, die langsame Metabolisierer von CYP2D6 sind. Die Plasmakonzentrationen werden dabei aber in sehr variablem Ausmass erhöht (10 bis 130 %).
Einzelfälle: Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien und weiteren Nebenwirkungen
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Antidepressiva und Neuroleptika ist das Risiko für ventrikuläre Tachykardien erhöht. Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen. Darüber hinaus können vermehrt anticholinerge (Mundtrockenheit, Akkommodations-, Miktionsstörungen, Obstipation) sowie zentraldämpfende Effekte vorkommen. Auch eine Absenkung der Krampfschwelle ist nicht auszuschliessen.
Antidepressiva und Neuroleptika sollen nur nach sorgfältiger Diagnosestellung und in niedrigst möglicher Dosis kombiniert werden. Patienten, die diese Kombination erhalten, sollen sorgfältig auf vermehrte kardiale und anticholinerge Nebenwirkungen sowie auf veränderte therapeutische Effekte überwacht werden. Besonders wenn Risikofaktoren vorliegen, sollen sie sorgfältig stationär und elektrokardiographisch überwacht werden; bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50-60 ms bzw. auf mehr als 460-500 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) soll das Serum-Kalium kontrolliert werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Proteinkinase-Inhibitoren - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben. Hinzu kommen pharmakokinetische Effekte bei einigen Proteinkinase-Inhibitoren (Bosutinib, Ceritinib, Crizotinib, Dasatinib, Lapatinib, Midostaurin, Nilotinib, Pazopanib, Sunitinib, Tivozanib, Vemurafenib), die über CYP3A4 verstoffwechselt werden, welches durch Clarithromycin, Erythromycin oder Telithromycin gehemmt werden kann.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit einigen Proteinkinase-Inhibitoren und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, ist das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Symptomatische Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle können auftreten. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit den genannten Proteinkinase-Hemmern und weiteren QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen soll möglichst vermieden werden. Ist die gleichzeitige Behandlung unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der herzfrequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50-60 ms bzw. auf 460-500 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) wird empfohlen, den Elektrolytstatus und besonders das Serum-Kalium zu überwachen. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Levofloxacin: Die Interaktion kann auch bei inhalativer Anwendung auftreten, da gelegentlich Plasmakonzentrationen wie nach peroraler Gabe vorkommen können.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Anticholinergika - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeDie verstärkten anticholinergen Wirkungen beruhen auf additiven peripheren und zentralen Wirkungen der Arzneistoffe. Wenige derartige Fälle wurden in der pharmakologischen Literatur berichtet. Unter den trizyklischen Antidepressiva wirken besonders Amitriptylin, Imipramin, Trimipramin und Nortriptylin stark anticholinerg.
Verstärkte anticholinerge Effekte
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Anticholinergika und tri-/tetrazyklischen Antidepressiva können anticholinerge Effekte vermehrt und verstärkt auftreten: Akkommodationsstörungen, Mydriasis, Mundtrockenheit, Obstipation, Tachykardie, Miktionsstörungen, Schweissminderung. Vor allem bei älteren Patienten können delirante Syndrome mit Verwirrtheit, Halluzinationen und Erregungszuständen sowie kognitive Störungen vorkommen und das Sturzrisiko ist erhöht. In Einzelfällen kann ein paralytischer Ileus, bei feuchtheissem Wetter durch die behinderte Regulation der Körpertemperatur ein Hitzschlag auftreten.
Bei gegebener Indikation kann gleichzeitig mit tri-/tetrazyklischen Antidepressiva und Anticholinergika behandelt werden, jeweils in möglichst niedriger Dosis. Die Patienten sollen besonders sorgfältig im Hinblick auf periphere und zentrale anticholinerge Effekte überwacht und die Notwendigkeit der gleichzeitigen Behandlung regelmässig überprüft werden; dies gilt besonders für ältere Patienten. Die Patienten sollen bei feuchtheissem Wetter übermässige Anstrengungen meiden.Solifenacin: Zwischen dem Ende einer Behandlung mit dem Inkontinenzmittel und der Anwendung anderer anticholinerg wirkender Arzneistoffe soll etwa eine Woche liegen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
QT-Zeit verlängernde Substanzen - Stoffe zur AndrogensuppressionDie Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben. Die kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken und sind dosisabhängig.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien
Eine Androgen-Entzugstherapie kann das QT-Intervall verlängern. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln, die ebenfalls das QT-Intervall verlängern können, ist daher das Risiko für ventrikuläre Tachykardien erhöht. Torsade de pointes mit Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen.
Bei Patienten, die gleichzeitig Arzneimittel erhalten, die das QT-Intervall verlängern können, ist vor dem Beginn einer Androgenentzugsbehandlung das Nutzen-Risiko-Verhältnis einschliesslich des Potenzials für Torsade de pointes sorgfältig abzuschätzen. Elektrolytstörungen und Bradykardien sollen vor der Anwendung korrigiert werden. Der Elektrolytstatus ist ebenfalls zu überwachen. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 60 ms bzw. auf über etwa 460-500 ms sollen die Risiko-Arzneimittel abgesetzt werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Yohimbin - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeYohimbin kann Angst, Unruhe und Reizbarkeit hervorrufen und insofern die therapeutischen Effekte der Antidepressiva abschwächen. Auch der Blutdruckanstieg könnte auf pharmakodynamischen Effekten beruhen: Yohimbin hemmt Alpha-2-Rezeptoren während tri- und tetrazyklische Antidepressiva die Noradrenalin-Wiederaufnahme hemmen. Darüber hinaus erhöhte Clomipramin in einer Studie die Plasmakonzentrationen von Yohimbin.
Blutdruckanstieg, verstärkte psychische Effekte
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Yohimbin und tri- bzw. tetrazyklischen Antidepressiva ist verstärkt mit Angst und anderen affektiven Reaktionen zu rechnen. Der Blutdruck kann steigen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Yohimbin und tri- bzw. tetrazyklischen Antidepressiva wird nicht empfohlen. Geschieht dies dennoch, ist sorgfältig der Blutdruck zu überwachen und auf psychische Effekte zu achten.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva - MAO-B-HemmerDie Interaktion beruht vermutlich auf der Verstärkung der Wirkungen von adrenergen und/oder serotoninergen Neurotransmittern. Antipressiva hemmen die Wiederaufnahme von Serotonin bzw. Noradrenalin oder wirken direkt agonistisch an Rezeptoren der Neurotransmitter. MAO-Hemmer erhöhen die Verfügbarkeit von Serotonin, indem sie den Abbau von Serotonin durch die Monoaminooxidasen (MAO), vorwiegend durch MAO-A und in geringem Ausmass auch MAO-B, hemmen.
Vermehrt schwere unerwünschte Wirkungen (z .B. Serotonin-Syndrom)
Seltene, aber schwerwiegende unerwünschte Wirkungen (z. B. Serotonin-Syndrom) wurden bei der gleichzeitigen Behandlung mit Hemmern der MAO-B (Rasagilin, Safinamid, Selegilin) und Antidepressiva berichtet. Serotogene Antidepressiva sind u.a. Serotonin-Reuptake-Hemmer, Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Hemmer bzw. trizyklische/tetrazyklische Antidepressiva. Symptome eines Serotonin-Syndroms: mentale (Verwirrtheit, Erregung, Agitiertheit, Unruhe), autonome (Schwitzen, Fieber, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckanstieg) und neuromuskuläre Störungen (Hyperreflexie, Krampfanfälle, Tremor). In schweren Fällen kann es zu Koma und Schock kommen. In einer Studie mit 4568 Patienten traten bei der gleichzeitigen Anwendung von Selegilin und einem Antidepressivum nur in 0,24 % der Fälle Symptome auf, welche in Zusammenhang mit einem Serotonin-Syndrom stehen könnten. Bei 0,04 % der Fälle handelte es sich um eine schwerwiegenden Nebenwirkung.
Die genannten Antidepressiva und die MAO-B-Hemmer Rasagilin bzw. Safinamid sollen nur unter sorgfältiger Überwachung und in den niedrigst wirksamen Dosen gleichzeitig angewandt werden. Die gleichzeitige Anwendung mit Selegilin ist kontraindiziert. MAO-Hemmer sollen nicht angewendet werden, wenn nach der Therapie mit dem serotogenen Antidepressivum nicht mindestens eine Auswaschphase entsprechend der 5-fachen Halbwertszeit eingehalten wurde; die jeweiligen Fachinformationen sind zu beachten. Serotogene Antidepressiva dürfen nicht angewendet werden, wenn die Beendigung der Selegilin-Therapie nicht mindestens 14 Tage zurückliegt.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Panobinostat - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben. Bei Antiarrhythmika beträgt die Inzidenz etwa 1:100 bis 4:100. Pharmakokinetische Interaktionen mit Plasmakonzentrationserhöhungen der Arzneistoffe können hinzukommen.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Panobinostat und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, sind vermehrt ventrikuläre Tachykardien zu befürchten. Torsade de pointes mit symptomatischen Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Panobinostat und den genannten weiteren QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen wird nicht empfohlen. Ist die gleichzeitige Behandlung mit mehreren QT-Zeit-verlängernden Arzneistoffen unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der herzfrequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50-60 ms bzw. auf 460-500 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) wird empfohlen, den Elektrolytstatus und besonders das Serum-Kalium zu überwachen. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Levofloxacin: Die Interaktion kann auch bei inhalativer Anwendung auftreten, da gelegentlich Plasmakonzentrationen wie nach peroraler Gabe vorkommen können.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Iobenguan[123I] - Stoffe, die die Catecholamin-Aufnahme blockierenIobenguan ist ein Noradrenalin-Derivat; wie dieses wird Iobenguan durch einen aktiven Prozess in adrenerge Gewebe (z. B. Nebennierenmark) aufgenommen und dort gespeichert. Das Ausmass der Aufnahme ist in pathologischen Geweben verändert und wird gemessen. Arzneistoffe, die den Mechanismus der Catecholamin-Aufnahme blockieren, wie trizyklische Antidepressiva und Reserpin, reduzieren die Anreicherung von Iobenguan und beeinträchtigen dadurch die Aussagekraft des Tests.
Beeinträchtigung der Aussagekraft des Iobenguan[123I]-Tests
Die Behandlung mit den genannten Arzneistoffen (Alpha-2-rezeptoragonisten, Antidepressiva, trizyklische, und Analoge, Reserpin, Tetrabenazin, Calciumantagonisten, Phenothiazine, indirekte Sympathomimetika) beeinträchtigt die Bestimmung der Noradrenalin-Speicherfähigkeit durch das Radiodiagnostikum Iobenguan[123I] und damit die Aussagekraft des Tests.
Die genannten Arzneistoffe sollen - wenn ärztlich vertretbar - etwa 1 Woche (etwa 4 biologische Halbwertszeiten) vor einer Untersuchung mit Iobenguan[123I] abgesetzt werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Ribociclib - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie arrhythmogenen Wirkungen von Ribociclib und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, könnten sich verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben. Pharmakokinetische Interaktionen mit Plasmakonzentrationserhöhungen der Arzneistoffe können hinzukommen. Ribociclib verlängert das frequenzkorrigierte QTc-Intervall konzentrationsabhängig: Die empfohlene Dosis von 600 mg verlängerte das QTc-Intervall im Gleichgewicht bei einer mittleren maximalen Plasmakonzentration von 2237 ng/ml im Schnitt um 22,87 ms.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Ribociclib und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, werden verstärkt Arrhythmien befürchtet. Torsade de pointes können mit Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Eine gleichzeitige Behandlung mit Ribociclib und anderen QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen wird im Allgemeinen nicht empfohlen, andernfalls wird eine häufige Kontrolle von EKG, Kaliämie und Magnesiämie empfohlen. Bei einer Verlängerung des QTcF-Intervalls müssen folgende Massnahmen beachtet werden: - QTcF 481–500 ms: Absetzen von Ribociclib bis QTcF auf <481 ms zurückkehrt, Wiederaufnahme von Ribociclib mit der nächst niedrigeren Dosis; gleiches Vorgehen bei Wiederauftreten von QTcF >=481 ms. - QTcF >500 ms: Absetzen von Ribociclib bis QTcF auf <481 ms zurückkehrt, Wiederaufnahme von Ribociclib mit der nächst niedrigeren Dosis. Das endgültige Absetzen von Ribociclib ist erforderlich bei QTcF >500 ms in Verbindung mit Torsades de pointes, polymorphen ventrikulären Tachykardien oder Zeichen/Symptomen schwerer Arrhythmie.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische - JohanniskrautInhaltsstoffe des Johanniskrauts induzieren Cytochrom-P-450-abhängige, Arzneistoff-metabolisierende Enzyme (CYP3A4, CYP2C19) bzw. den Efflux-Transporter P-Glycoprotein und können so die Plasmakonzentrationen der trizyklischen Antidepressiva senken. Bei 12 depressiven Patienten verringerte ein Johanniskraut-Extrakt, 900 mg täglich über mindestens 14 Tage, die AUC von Amitriptylin, 75 mg zweimal täglich, im Schnitt um 22 % und die des aktiven Metaboliten Nortriptylin um ca. 41 %.
Verminderte antidepressive Wirksamkeit möglich
Johanniskraut-Extrakte können möglicherweise die Wirksamkeit von trizyklischen Antidepressiva beeinträchtigen.
Da die gleichzeitige Behandlung mit trizyklischen Antidepressiva und Johanniskraut-Extrakten nicht untersucht wurde, soll nur eines der beiden Therapeutika eingesetzt werden. Wird dennoch gleichzeitig mit beiden behandelt, ist sorgfältig auf ausreichende Wirksamkeit zu achten.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - Antibiotika, QT-Zeit-verlängernde (Chinolone)Die kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken und sind dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben. Die meisten der betroffenen Patienten weisen einen oder mehrere der genannten Risikofaktoren auf.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit mehreren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, wie einige Antibiotika und Antidepressiva, steigt das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes. Symptomatische Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle können auftreten. Meist enden Torsade de pointes spontan; sehr selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Antidepressiva und Chinolonen soll möglichst vermieden werden; Alternativarzneimittel sind zu bevorzugen. Ist sie nötig, soll sie in niedrigst wirksamer Dosis sowie unter sorgfältiger EKG-Überwachung vorgenommen werden. Elektrolytstörungen und Bradykardien sollen vor der Anwendung korrigiert werden. Der Elektrolytstatus ist ebenfalls zu überwachen. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50 ms bzw. auf über etwa 460 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden. Die Interaktion kann auch bei inhalativer Levofloxacin-Anwendung auftreten, da gelegentlich Plasmakonzentrationen wie nach peroraler Gabe auftreten können.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - TelavancinDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken und sind dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben. Die meisten der betroffenen Patienten weisen einen oder mehrere der genannten Risikofaktoren auf.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Telavancin und einigen Antidepressiva, steigt das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes. Symptomatische Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle können auftreten. Meist enden Torsade de pointes spontan; sehr selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Antidepressiva und weiteren QT-Zeit-verlängernden Arzneistoffen soll möglichst vermieden werden; Alternativarzneimittel sind zu bevorzugen. Ist sie nötig, soll sie in niedrigst wirksamer Dosis sowie unter sorgfältiger EKG-Überwachung vorgenommen werden. Elektrolytstörungen und Bradykardien sollen vor der Anwendung korrigiert werden. Der Elektrolytstatus ist ebenfalls zu überwachen. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50 ms bzw. auf über etwa 460 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - H1-BlockerAntidepressiva und H1-Blocker verlängern additiv und dosisabhängig die QT-Zeit im EKG. Die meisten der betroffenen Patienten weisen einen oder mehrere Risikofaktoren auf. Die verstärkten anticholinergen Wirkungen beruhen auf additiven peripheren und zentralen Wirkungen der Arzneistoffe. Unter den trizyklischen Antidepressiva wirken besonders Amitriptylin, Imipramin, Trimipramin und Nortriptylin stark anticholinerg. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien, verstärkte anticholinerge Wirkungen
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-Zeit-verlängernden Antidepressiva und einigen H1-Blockern ist das Risiko für ventrikuläre Tachykardien und Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Symptome sind Herzklopfen, Benommenheit, Schwindel und Ohnmachtsanfälle. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen. Torsade de pointes treten selten in den ersten 3 Tagen einer Behandlung auf; häufiger kommen sie nach 3 bis 30 Tagen oder später vor. Auch anticholinerge Effekte können vermehrt und verstärkt auftreten: Akkommodationsstörungen, Mydriasis, Mundtrockenheit, Obstipation, Tachykardie, Miktionsstörungen, Schweissminderung. Vor allem bei älteren Patienten können delirante Syndrome mit Verwirrtheit, Halluzinationen und Erregungszuständen sowie kognitive Störungen vorkommen und das Sturzrisiko kann erhöht sein.
Die gleichzeitige Behandlung mit mehreren QT-Zeit-verlängernden Arzneistoffen ist möglichst zu vermeiden, besonders bei Patienten mit Risikofaktoren. Ist die gleichzeitige Behandlung unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit um mehr als 50 ms bzw. auf mehr als 460-500 ms (unterschiedl. Grenzwerte werden genannt) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) soll das Serum-Kalium überwacht werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Herzklopfen, Benommenheit, Schwindel oder Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden. Auch im Hinblick auf periphere und zentrale anticholinerge Effekte soll sorgfältig überwacht werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Vandetanib - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Vandetanib und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, ist das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Symptomatische Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle können auftreten. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Vandetanib und weiteren QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen soll möglichst vermieden werden. Ist die gleichzeitige Behandlung unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der herzfrequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50-60 ms bzw. auf 460-500 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) wird empfohlen, den Elektrolytstatus und besonders das Serum-Kalium zu überwachen. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Levofloxacin: Die Interaktion kann auch bei inhalativer Anwendung auftreten, da gelegentlich Plasmakonzentrationen wie nach peroraler Gabe vorkommen können.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Clomethiazol - Zentraldämpfende StoffeDie Wechselwirkung beruht auf additiven pharmakodynamischen Effekten.
Verstärkte zentraldämpfende Wirkungen
Benzodiazepine, Opioide und Barbiturate verstärken die zentraldämpfenden Effekte von Clomethiazol. Sedierung, Benommenheit und Konzentrationsstörungen können vermehrt bzw. verstärkt auftreten. In Einzelfällen können lebensbedrohliche Zustände durch Atemdepression und kardiovaskuläre Effekte auftreten.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Clomethiazol und zentraldämpfenden Stoffen muss die Dosierung entsprechend reduziert werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Vorinostat - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie arrhythmogenen Wirkungen der betroffenen Arzneistoffe können sich addieren und sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Vorinostat und weiteren Stoffen, die die QT-Zeit verlängern können, werden verstärkt Arrhythmien, insbesondere Torsade de pointes, befürchtet.
Die gleichzeitige Behandlung mit Vorinostat und anderen QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen ist möglichst zu vermeiden; andernfalls wird eine regelmässige Kontrolle von EKG sowie Kaliämie und Magnesiämie empfohlen, inbesondere bei Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Herzbeschwerden. Bei einer Verlängerung des QTc-Intervalls um mehr als 50–60 ms oder auf mehr als 460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) müssen die betroffenen Arzneimittel abgesetzt werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
QT-Zeit verlängernde Substanzen - EnzalutamidDie Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1 000 000 angegeben. Die kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken und sind dosisabhängig.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien
Eine Androgen-Entzugstherapie mit Enzalutamid kann das QT-Intervall verlängern. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln, die ebenfalls das QT-Intervall verlängern können, ist daher das Risiko für ventrikuläre Tachykardien erhöht. Torsade de pointes mit Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen können auftreten. In seltenen Fällen können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand übergehen.
Bei Patienten, die gleichzeitig Arzneimittel erhalten, die das QT-Intervall verlängern können, ist vor dem Beginn einer Androgenentzugsbehandlung das Nutzen-Risiko-Verhältnis einschliesslich des Potenzials für Torsade de pointes sorgfältig abzuschätzen. Elektrolytstörungen und Bradykardien sollen vor der Anwendung korrigiert werden. Der Elektrolytstatus ist ebenfalls zu überwachen. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 60 ms bzw. auf über etwa 460-500 ms sollen die Risiko-Arzneimittel abgesetzt werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - EnzyminduktorenDurch Induktion der Cytochrom-P-450-abhängigen Enzyme, die den oxidativen Metabolismus der Antidepressiva katalysieren (CYP1A2, CYP3A4, CYP2C, CYP2D6), kann die Elimination der Antidepressiva beschleunigt werden. Meist wurden um 30-50 % verminderte Plasmakonzentrationen der Antidepressiva gefunden. Dabei zeigte nur ein Teil der Patienten eine verminderte antidepressive Wirksamkeit. Die Enzyminduktion entwickelt sich im Verlauf einiger Tage und kann nach Absetzen des Enzyminduktors einige Wochen anhalten.
Verminderte Wirksamkeit der Antidepressiva möglich
Die Wirksamkeit der betroffenen Antidepressiva kann in Einzelfällen im Verlauf weniger Tage durch Enzyminduktoren wie Barbiturate, Carbamazepin, Phenytoin und Rifampicin abgeschwächt werden.
Ist die gleichzeitige Behandlung mit einem enzyminduzierenden Arzneistoff erforderlich, soll auf eine eventuell verminderte Wirksamkeit des Antidepressivums geachtet und dessen Dosierung nach Bedarf erhöht werden. Nach dem Absetzen des Enzyminduktors muss die Dosierug des Antidepressivums wieder verringert werden. Alternative Antiepileptika, Hypnotika oder Tuberkulostatika können erwogen werden. Bei der Behandlung von Patienten mit Epilepsie ist ausserdem zu bedenken, dass Antidepressiva die Krampfschwelle senken.
Vorsichtshalber überwachen
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - CimetidinCimetidin ist ein schwacher Inhibitor der Isoenzyme CYP1A2, CYP2D6 und CYP3A4, die den oxidativen Metabolismus der Antidepressiva katalysieren. Von der Wechselwirkung scheinen besonders Antidepressiva mit hohem First-Pass-Effekt wie Imipramin und Amitriptylin betroffen zu sein. In einer Studie war die Bioverfügbarkeit von Imipramin durch gleichzeitige Einnahme von Cimetidin ca. um das 2,7-Fache erhöht. Die H2-Blocker Ranitidin und Famotidin haben keinen hemmenden Effekt auf den oxidativen Metabolismus der Antidepressiva.
Verstärkte Nebenwirkungen der Antidepressiva
Die gleichzeitige Behandlung mit Cimetidin kann die Wirkungen von tri- bzw. tetrazyklischen Antidepressiva innerhalb einiger Tage verstärken. Dosisabhängige Nebenwirkungen der Antidepressiva wie Sedation, orthostatische Hypotonie, Mundtrockenheit, Akkommodationsstörungen, Miktionsstörungen und Obstipation können verstärkt auftreten.
Wenn möglich, sollen alternativ die H2-Blocker Ranitidin oder Famotidin eingesetzt werden. Ist die gleichzeitige Behandlung mit Cimetidin unumgänglich, sollen die Patienten auf unerwünschte Wirkungen der tri- bzw. tetrazyklischen Antidepressiva überwacht werden. Bei Bedarf sollte die Dosis der Antidepressiva reduziert werden.
Vorsichtshalber überwachen
Sympathomimetika, indirekte - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeIndirekt wirkende Sympathomimetika setzen Noradrenalin aus noradrenergen Neuronen frei. In Gegenwart von Antidepressiva ist die Wiederaufnahme von Noradrenalin in die Speicher vermindert, so dass dieser Wirkungsmechanismus nicht mehr greift. Somit ist theoretisch initial eine verstärkte, dann aber eine abgeschwächte sympathomimetische Wirkung zu erwarten.
Erst verstärkte, dann abgeschwächte sympathomimetische Wirkung
Die sympathomimetische Wirkung von indirekten Sympathomimetika kann durch Antidepressiva verstärkt (Blutdruckanstieg, Tachykardie), später eventuell abgeschwächt werden.
Auf Appetitzügler und Kombinationsarzneimittel zur Behandlung von Erkältungskrankheiten kann während einer Behandlung mit Antidepressiva in der Regel ohne Nachteile verzichtet werden. Ist die gleichzeitige Behandlung erforderlich, soll der Blutdruck kontrolliert werden. Sympathomimetika mit psychostimulierender Wirkung können unter sorgfältiger Beobachtung mit trizyklischen Antidepressiva kombiniert werden.
Vorsichtshalber überwachen
Sympathomimetika, direkte - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeAntidepressiva hemmen die Inaktivierung von Norepinephrin durch Hemmung der Wiederaufnahme in die präsynaptischen Speicher. Auch eine Hemmung der Inaktivierung von exogen zugeführten, direkten Sympathomimetika ist nicht auszuschliessen. Über Häufigkeit und Ausmass dieser theoretisch möglichen Interaktion ist nichts bekannt.
Verstärkte sympathomimetische Wirkung möglich
Die gleichzeitige Behandlung mit Antidepressiva kann die Wirkungen von Sympathomimetika verstärken, die systemisch als Antihypotonika bzw. Antiasthmatika oder lokal zur Schleimhautabschwellung eingesetzt werden, und z. B. einen Blutdruckanstieg hervorrufen.
Müssen Sympathomimetika und Antidepressiva zusammen angewandt werden, sollen Blutdruck und Herzfunktion sorgfältig überwacht werden. Auf Schleimhautabschweller (nasal, konjunktival) kann zugunsten von physiologischer Kochsalzlösung oder künstlichen Tränen verzichtet werden.
Vorsichtshalber überwachen
Antidepressiva, trizyklische - TerbinafinTerbinafin hemmt den oxidativen Metabolismus der trizyklischen Antidepressiva durch CYP2D6, speziell die O-Demethylierung. 2- bis 3-fach erhöhte Plasmakonzentrationen von Amitriptylin, Imipramin und Nortriptylin wurden in Einzelfällen gemessen. In einer Studie an 12 Probanden erhöhte Terbinafin in therapeutischer Dosierung die Bioverfügbarkeit von Desipramin auf das 5-Fache.
Verstärkte unerwünschte Wirkungen der Antidepressiva möglich
Innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach Beginn einer gleichzeitigen Behandlung mit Terbinafin können verstärkte Wirkungen von trizyklischen Antidepressiva auftreten. Dosisabhängige unerwünschte Wirkungen der Antidepressiva wie Sedation, Koordinationsstörungen, orthostatische Hypotonie, Herzrhythmusstörungen und anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Akkommodationsstörungen, Miktionsstörungen und Obstipation können verstärkt auftreten.
Ist die gleichzeitige Behandlung mit Terbinafin erforderlich, soll auf Überdosierungssymptome der trizyklischen Antidepressiva besonders geachtet und die Dosierung nach Bedarf gesenkt werden. Die Interaktion kann auch nach Absetzen von Terbinafin noch bis zu mehreren Wochen oder Monaten auftreten bzw. weiterbestehen, da dieses eine variable, aber in der Regel sehr lange Halbwertszeit hat.
Vorsichtshalber überwachen
Vitamin-K-Antagonisten - Antidepressiva, trizyklische, und AnalogeEinige trizyklische Antidepressiva scheinen den oxidativen Metabolismus der Vitamin-K-Antagonisten zu hemmen und so deren Plasmakonzentrationen zu erhöhen; weitere Mechanismen spielen aber offenbar eine Rolle.
Verstärkte oder verminderte blutgerinnungshemmende Wirkung
Trizyklische Antidepressiva und Analoge (Amitriptylin, Amitriptylinoxid, Clomipramin, Dosulepin, Doxepin, Imipramin, Maprotilin, Mianserin, Nortriptylin, Opipramol, Trazodon, Trimipramin) können die blutgerinnungshemmende Wirkung der Vitamin-K-Antagonisten bei einem Teil der Patienten in unvorhersehbarer Weise verstärken, seltener auch abschwächen (Trazodon) und so die stabile Einstellung der Patienten erschweren; der veränderte blutgerinnungshemmende Effekt kann innerhalb weniger Tage eintreten.
Bei Patienten, die gleichzeitig mit Vitamin-K-Antagonisten und trizyklischen Antidepressiva oder deren Analoga behandelt werden, sollen die Blutgerinnungsparameter fortlaufend sehr sorgfältig überwacht werden.
Vorsichtshalber überwachen
Antidepressiva, trizyklische - VenlafaxinDer Interaktion könnten sowohl additive Effekte als auch eine Hemmung des oxidativen Metabolismus der trizyklischen Antidepressiva durch CYP2D6 zu Grunde liegen. Venlafaxin beeinflusste die Pharmakokinetik von Imipramin und 2-Hydroxyimipramin nicht. Die Bioverfügbarkeit des aktiven Desipramin-Metaboliten 2-Hydroxydesipramin war dosisabhängig um das 2,5- bis 4,5-Fache erhöht, wenn 75 mg bis 150 mg Venlafaxin täglich gegeben wurden.
Verstärkte Wirkungen der trizyklischen Antidepressiva möglich
In Einzelfällen wurden bei gleichzeitiger Behandlung mit Venlafaxin verstärkte Wirkungen der trizyklischen Antidepressiva beobachtet: verstärkte anticholinerge Effekte (Urinretention, Ileus, Konfusion), Serotonin-Syndrom (Konfusion, Erregung, Angst, Schwitzen, Hyperthermie, Diarrhoe, Übelkeit, Blutdruckschwankungen, Hyperreflexie, Tremor, Nystagmus) sowie Krampfanfälle.
Bei gleichzeitiger Behandlung von Venlafaxin und trizyklischen Antidepressiva ist Vorsicht geboten. Auf die genannten unerwünschten Wirkungen soll - auch durch den Patienten bzw. dessen Angehörige - besonders geachtet werden, damit im Falle ihres Auftretens frühzeitig Gegenmassnahmen ergriffen werden können.
Vorsichtshalber überwachen
Antidepressiva, trizyklische - ValproinsäureDer Mechanismus ist spekulativ: Möglicherweise hemmt Valproinsäure CYP2C9, das Anteil am oxidativen Metabolismus einiger trizyklischer Antidepressiva hat. Moderat erhöhte Plasmakonzentrationen von Amitriptylin und seinem Metaboliten Nortriptylin wurden bei gleichzeitiger Behandlung mit Amitriptylin und Valproinsäure gemessen.
Verstärkte Wirkungen der trizyklischen Antidepressiva möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Valproinsäure können nach einigen Tagen verstärkte Wirkungen der trizyklischen Antidepressiva auftreten. Schlafstörungen, Tremor, verstärkte anticholinerge Effekte und Krampfanfälle wurden in Einzelfällen mit Amitriptylin, Clomipramin bzw. Nortriptylin berichtet.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit trizyklischen Antidepressiva und Valproinsäure soll besonders auf unerwünschte Effekte geachtet werden, die aus erhöhten Plasmakonzentrationen des Antidepressivums herrühren könnten. In diesem Fall soll die Behandlung entsprechend individuell angepasst werden (z. B. Dosisreduktion des Antidepressivums, Absetzen von Valproinsäure).
Vorsichtshalber überwachen
Substrate (CYP2D6) - MirabegronMirabegron ist ein moderater Hemmstoff von CYP2D6 und kann den Metabolismus von Arzneistoffen hemmen, die wesentlich durch dieses Isoenzym abgebaut werden. Die mehrmalige einmal tägliche Einnahme von schnell freisetzendem Mirabegron (160 mg) bewirkte einen Anstieg der AUC einer Einzeldosis von Metoprolol (100 mg) um ca. 229 % und der AUC einer Einzeldosis Desipramin (50 mg) um ca. 241 %.
Verstärkte Wirkungen der CYP2D6-Substrate möglich
Die gleichzeitige Behandlung mit Mirabegron kann die Wirkungen von Arzneistoffen verstärken, die durch CYP2D6 abgebaut werden (Thioridazin, trizyklische Antidepressiva, Metoprolol). Je nach dem jeweiligen pharmakologischen Profil können verstärkte unerwünschte Effekte auftreten.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Mirabegron und Arzneistoffen mit enger therapeutischer Breite oder individueller Dosierung, die durch CYP2D6 metabolisiert werden, ist Vorsicht geboten. Eine Dosisreduktion des CYP2D6-Substrats soll in Betracht gezogen werden.
Vorsichtshalber überwachen
Substrate (CYP2D6) - EliglustatEliglustat hemmt CYP2D6: Die gleichzeitige, wiederholte, zweimal tägliche Gabe von 127 mg Eliglustat erhöhte die Bioverfügbarkeit einer 50-mg-Einzeldosis des CYP2D6-Substrats Metoprolol auf etwa das 2,1-Fache.
Verstärkte Wirkungen der CYP2D6-Substrate möglich
Die Wirkungen von Stoffen, die über CYP2D6 abgebaut werden (wie trizyklische Antidepressiva, Phenothiazin-Derivate, Dextromethorphan, Metoprolol, Atomoxetin) können durch gleichzeitige Behandlung mit Eliglustat verstärkt werden. Substanzspezifische unerwünschte Wirkungen können vermehrt bzw. verstärkt auftreten.
Eine Verringerung der Dosis von CYP2D6-Substraten kann erforderlich sein.
Vorsichtshalber überwachen
Vasopressin-Analoge - AntidepressivaAntidepressiva können sehr selten infolge einer inadäquaten Sekretion des antidiuretischen Hormons (SIADH) eine Hyponatriämie hervorrufen und so die antidiuretischen Wirkungen von Vasopressin-Analogen verstärken.
Erhöhtes Risiko für Wasserintoxikationen bzw. Hyponatriämien
Die gleichzeitige Behandlung mit Antidepressiva kann die Wirkungen von Vasopressin-Analogen verstärken und so im Verlauf der Behandlung das Risiko für eine Wasserintoxikation bzw. eine Hyponatriämie mit Kopfschmerzen, Schwindel, Ödemen, Übelkeit, Verwirrtheit und in schweren Fällen Krampfanfällen und Koma erhöhen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Vasopressin-Analogen und Antidepressiva soll mit Vorsicht erfolgen: Die Flüssigkeitszufuhr soll eingeschränkt (Trinken nur bei Durst, Überwachung des Körpergewichts) und die Natrium-Serumkonzentration häufiger gemessen werden.
Vorsichtshalber überwachen
Enzalutamid - Stoffe, die die Krampfschwelle senkenDie Interaktion beruht auf additiven Effekten der betroffenen Arzneimittel auf die Krampfschwelle.
Erhöhtes Risiko von Krampfanfällen
Die gleichzeitige Behandlung mit Enzalutamid und weiteren Arzneimitteln, die die Krampfschwelle senken (Neuroleptika, Antidepressiva, Antimalariamittel, Atomoxetin, Tramadol, Theophyllin, Chinolone, sedierenden Antihistaminika, Stimulantien, Appetitzügler), kann das Risiko von Krampfanfällen erhöhen.
Die Entscheidung über eine gleichzeitige Behandlung mit Enzalutamid und weiteren Arzneimitteln, die die Krampfschwelle senken, soll ärztlich sorgfältig abgewogen werden. Wenn ein Krampfanfall auftritt, ist die Behandlung abzubrechen. Levofloxacin: Die Interaktion kann auch bei inhalativer Anwendung auftreten, da gelegentlich Plasmakonzentrationen wie nach peroraler Gabe vorkommen können.
Vorsichtshalber überwachen
Antidepressiva - DiuretikaAntidepressiva können infolge einer inadäquaten Sekretion des antidiuretischen Hormons (SIADH) eine Hyponatriämie hervorrufen. Fälle von Natrium-Serumkonzentrationen unter 110 mmol/l wurden berichtet. In einer grossangelegten Kohortenstudie waren vor allem Serotonin-Reuptake-Hemmer (besonders Citalopram), aber auch trizyklische Antidepressiva mit einer Hyponatriämie assoziiert, während Mianserin kein erhöhtes Risiko aufzeigte. Diuretika können ebenfalls Natriumverluste und auch Kaliumverluste bewirken und zu einer Hyponatriämie oder Hypokaliämie führen, die das Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes) additiv mit den Antidepressiva erhöht.
Erhöhtes Risiko für Hyponatriämien und ventrikuläre Arrhythmien
Die gleichzeitige Behandlung mit Antidepressiva und Diuretika kann im Verlauf der Behandlung das Risiko für eine Wasserintoxikation bzw. eine Hyponatriämie mit Kopfschmerzen, Übelkeit, Verwirrtheit, Schwäche und in schweren Fällen Krampfanfällen erhöhen. Des Weiteren begünstigt eine durch Diuretika ausgelöste Hypokaliämie das Auftreten von ventrikuläre Arrhythmien (Torsade de pointes) durch Antidepressiva. Symptomatische Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle können auftreten.
Antidepressiva und Diuretika sollen mit Vorsicht gleichzeitig eingesetzt werden. Die Kalium und Natrium-Serumkonzentrationen sollen im Verlauf der gleichzeitigen Behandlung häufiger gemessen werden. Wird eine Hyponatriämie festgestellt, soll zunächst die Flüssigkeitszufuhr eingeschränkt werden (Trinken nur bei Durst, Überwachung des Körpergewichts); wenn möglich sollen die auslösenden Arzneimittel abgesetzt werden. Weitergehende therapeutische Massnahmen können nötig werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 60 ms bzw. auf über etwa 460-500 ms sollen die Risiko-Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko informiert werden und bei Schwindel, Benommenheit, Palpitationen und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Verzehr von Lakritze ist zu meiden.
Vorsichtshalber überwachen
Antidepressiva, trizyklische, und Analoge - Methylphenidat, DexmethylphenidatEs gibt Hinweise, dass Methylphenidat den oxidativen Metabolismus der Antidepressiva hemmt. Eine verstärkte sympathomimetische Wirkung von Methylpenidat wird theoretisch erwartet, da Methylphenidat Noradrenalin aus adrenergen Neuronen freisetzt und in Gegenwart von trizyklischen Antidepressiva die Wiederaufnahme von Noradrenalin vermindert wird.
Verstärkte Wirkungen der trizyklischen Antidepressiva, Blutdruckanstieg, Tachykardie
Methylphenidat kann die Wirkungen von Antidepressiva verstärken. Dosisabhängige Nebenwirkungen der Antidepressiva wie Sedation, orthostatische Hypotonie, Mundtrockenheit, Akkommodationsstörungen, Miktionsstörungen und Obstipation können verstärkt auftreten. Eine verstärkte sympathomimetische Wirkung (Blutdruckanstieg, Tachykardie) von Methylphenidat ist theoretisch möglich.
Bei einer Kombination mit Antidepressiva empfiehlt es sich zu Beginn und Ende der Methylphenidat-Therapie auf verstärkte bzw. verminderte Wirkungen zu achten und ggf. die Dosis des Antidepressivums nach Bedarf anzupassen.
Vorsichtshalber überwachen
Tilidin - Stoffe, die serotoninerg wirkenDas Serotonin-Syndrom beruht auf einer Überstimulation von Serotonin-Rezeptoren im ZNS. Die serotoninergen Wirkungen der Arzneistoffe wie Hemmung des Serotonin-Abbaus, Hemmung der Wiederaufnahme, Serotonin-Freisetzung bzw. Serotonin-Agonismus addieren bzw. potenzieren sich. Allerdings wurden bislang für Tilidin keinen serotoninergen Effekte beschrieben.
Verstärkte serotoninerge Wirkung möglich - Gefahr eines Serotonin-Syndroms
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Tilidin und anderen serotoninerg wirkenden Arzneistoffen (MAO-Hemmer, trizyklische Antidepressiva, Setrone) ist nach Herstellerangaben das Risiko für ein Serotonin-Syndrom erhöht. Symptome eines Serotonin-Syndroms: mentale (Verwirrtheit, Erregung, Agitiertheit, Unruhe), autonome (Schwitzen, Fieber, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckanstieg) und neuromuskuläre Störungen (Hyperreflexie, Krampfanfälle, Tremor). In schweren Fällen kann es zu Koma und Schock kommen.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit serotoninergen Arzneimitteln ist nach Angaben der Tilidin/Naloxon-Fachinformationen Vorsicht geboten. Wird ein Serotonin-Syndrom vermutet, soll das Absetzen von Tilidin/Naloxon in Betracht gezogen werden.
Vorsichtshalber überwachen
Pitolisant - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie kardiotoxischen Effekte der Arzneistoffe können sich additiv verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben.
Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Pitolisant und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, ist das Risiko von Herzrhythmusstörungen vom Typ Torsade de pointes erhöht. Symptomatische Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle können auftreten. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Behandlung mit Pitolisant und Arzneistoffen, die bekanntermassen Verlängerungen des QT-Intervalls hervorrufen können.
Vorsichtshalber überwachen
Ranolazin - QT-Zeit verlängernde SubstanzenDie arrhythmogenen Wirkungen von Ranolazin und weiteren Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, könnten sich verstärken. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig. Die Häufigkeit von Torsade de pointes bei Arzneimitteln mit nicht-kardialer Indikation wird mit 1:100 000 bis 1:1000 000 angegeben. Pharmakokinetische Interaktionen mit Plasmakonzentrationserhöhungen der Arzneistoffe können hinzukommen. Eine Populationsanalyse bei Patienten und gesunden Freiwilligen zeigte, dass das QTc um etwa 2,4 ms pro 1000 ng/ml Ranolazin stieg, was bei einer Dosis von 500–1000 mg Ranolazin zweimal täglich einem Anstieg von 2–7 ms entspricht.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Ranolazin und anderen Arzneistoffen, die die QT-Zeit verlängern können, werden verstärkt Arrhythmien befürchtet. Torsade de pointes können mit Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Ranolazin und weiteren QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen ist Vorsicht geboten. Eine EKG Überwachung empfohlen. Bei einer Verlängerung der herzfrequenzkorrigierten QTc-Zeit von mehr als 50-60 ms bzw. auf 460-500 ms (unterschiedliche Grenzwerte werden angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) wird empfohlen, den Elektrolytstatus und besonders das Serum-Kalium zu überwachen. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Vorsichtshalber überwachen
Baclofen - Antidepressiva, trizyklischeDiese Interaktion beruht wahrscheinlich auf einer additiven Wirkung auf die Muskulatur, da sowohl Baclofen als auch trizyklische Antidepressiva eine Muskelhypotonie verursachen können.
Erhöhtes Risiko einer Muskelhypotonie
Die gleichzeitige Behandlung mit Baclofen und trizyklischen Antidepressiva kann die Wirkung von Baclofen verstärken und zu erheblicher Muskelhypotonie führen.
Bei gleichzeitiger Anwendung von Baclofen mit trizyklischen Antidepressiva ist Vorsicht geboten.
Vorsichtshalber überwachen
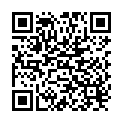
Variants
Description
Was ist Trimipramin Sandoz und wann wird es angewendet?
Trimipramin Sandoz wird zur Behandlung von Depressionen eingesetzt. Es hellt die Stimmung auf, mildert Angstzustände, beseitigt Traurigkeit und innere Unruhe und wirkt bei Schlaflosigkeit psychischen Ursprungs. Trimipramin Sandoz darf nur auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin angewendet werden.
Wann darf Trimipramin Sandoz nicht eingenommen werden?
Sie dürfen Trimipramin Sandoz nicht einnehmen bei Überempfindlichkeit auf den Wirkstoff Trimipramin oder einen Hilfsstoff von Trimipramin Sandoz, bei gleichzeitiger Einnahme eines MAO-Hemmers (z.B. zur Behandlung von Depressionen oder von Parkinson-Krankheit), ferner bei vergrösserter Prostata mit Beschwerden beim Wasserlösen, bei massiv erhöhtem Augeninnendruck (Glaukom), bei schweren Reizleitungsstörungen des Herzes sowie während der Erholungsphase nach einem frischen Herzinfarkt.
Wann ist bei der Einnahme von Trimipramin Sandoz Vorsicht geboten?
Unter der Behandlung mit Trimipramin Sandoz können sich die Symptome der Depression, insbesondere suizidalen Verhaltens, verschlechtern. In diesem Fall sollten Sie umgehend Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin kontaktieren.
Bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen oder anderen psychiatrischen Diagnosen wurde unter der Behandlung mit Antidepressiva über ein vermehrtes Auftreten von Verhaltensstörungen, inkl. erhöhtem Risiko von Suizidgedanken, Selbstverletzungen und vollendetem Suizid berichtet.
Daten aus klinischen Studien mit jungen Erwachsenen bis 25 Jahren mit psychiatrischen Störungen, die mit Antidepressiva behandelt wurden, haben ein erhöhtes Risiko für suizidales Verhalten gezeigt.
Ein Abbruch der Behandlung darf nicht plötzlich erfolgen und nur in Absprache mit Ihrem Arzt bzw. mit Ihrer Ärztin erfolgen, da es sonst zu Entzugssymptomen kommen kann.
Studien haben ein erhöhtes Diabetesrisiko in Verbindung mit trizyklischen Antidepressiva gezeigt.
Serotonin-Syndrom: Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Medikamente mit Trimipramin-ähnlicher Wirkung einnehmen.
Bei gleichzeitiger Einnahme von Trimipramin Sandoz und anderen Arzneimitteln (z.B. Arzneimittel gegen Epilepsie, Parkinson-Krankheit, Allergien, Gemütserkrankungen oder Herzrhythmusstörungen, Schlaf- und Beruhigungsmittel, andere Arzneimittel gegen Depressionen, Blutverdünner, magensäurehemmende Arzneimittel, blutdrucksteigernde oder -senkende Arzneimittel, Triptane, einige Schmerzmittel wie Tramadol oder Buprenorphin, Lithium, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), selektive Serotonin-/Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI) und Johanniskraut) kann es zu gegenseitiger Beeinflussung kommen. Teilen Sie deshalb Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin mit, wenn Sie gleichzeitig andere Arzneimittel einnehmen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin auch, wenn Sie Ohnmachtsanfälle haben, an anderen Krankheiten leiden oder Allergien haben.
Diese Medikamente erhöhen das Risiko von Nebenwirkungen. Beim Serotoninsyndrom einer potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung, treten Bewusstseinsstörungen, Muskelsteifheit (Rigor), Zittern (Tremor), unwillkürliche Muskelzuckungen und Fieber auf.
Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn solche Symptome auftreten.
Baclofen: Bei gleichzeitiger Anwendung von Baclofen und Trimipramin kann es zu einer Verringerung des Muskeltonus kommen.
Antikonvulsiva (z.B. Valproinsäure und Valpromid): Bei gleichzeitiger Einnahme von Trimipramin und einem Antikonvulsivum besteht ein Risiko für generalisierte Anfälle. Dies hängt damit zusammen, dass das Antidepressivum die Krampfschwelle herabsetzt.
Trimipramin Sandoz kann dosisabhängig das QT-Intervall verlängern (den Herzschlag verlangsamen und das EKG verändern).
Falls Sie an Herz-/Kreislaufstörungen (z.B. tiefer Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, koronare Herzkrankheit), nicht insulinabhängiger Zuckerkrankheit (Typ-II-Diabetes), schweren Leber- oder Nierenerkrankungen, Epilepsie, erhöhtem Augeninnendruck oder Prostatabeschwerden leiden, sollten Sie mit der Einnahme von Trimipramin Sandoz vorsichtig sein. Bei Patienten mit Schilddrüsenüberfunktion ist Trimipramin Sandoz mit besonderer Vorsicht anzuwenden, weil Antidepressiva zu Herzrhythmusstörungen führen können. Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Verwendung von anderen Arzneimitteln z.B. zur Behandlung von Asthma (Adrenalin-Analoge), von Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren (Cimetidin), zur Gewichtsreduktion (Appetitzügler), gegen Depressionen, gegen andere psychische Störungen, gegen Herzrhythmusstörungen (z.B. Chinidin, Amiodaron) und gewissen Arzneimitteln gegen Bluthochdruck (Reserpin, Guanethidin, Clonidin, Methyldopa).
Mit besonderer Vorsicht anzuwenden ist Trimipramin Sandoz bei älteren Patienten mit
- einer hohen Empfindlichkeit gegenüber einer Sedierung und einem niedrigen Blutdruck im Stehen,
- chronischer Verstopfung (kann das Risiko für starke Magenschmerzen mit Blähungen, intestinalen Krämpfen und Erbrechen erhöhen),
- einer Vergrösserung der Prostata.
Trimipramin Sandoz verstärkt die Wirkung von Alkohol, gewissen Schlafmitteln, anderen zentral beruhigenden oder auf die Psyche wirkenden Arzneimitteln. Von Alkoholkonsum während der Behandlung wird grundsätzlich abgeraten. Falls ein chirurgischer Eingriff bevorsteht, sollten Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin informieren. Trimipramin Sandoz kann Schläfrigkeit und verschwommenes Sehen verursachen und dadurch die Reaktionsfähigkeit, die Fahrtüchtigkeit und Fähigkeit, Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen, beeinträchtigen.
Trimipramin Sandoz Tabletten enthalten Lactose. Bitte nehmen Sie Trimipramin Sandoz Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
Trimipramin Sandoz Tabletten und Tropfen enthalten weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette resp. pro 1 ml Lösung (entsprechen 40 Tropfen), d.h. sie sind nahezu «natriumfrei».
Trimipramin Sandoz Tropfen zum Einnehmen enthalten 12 Vol.-% Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 960 mg pro 10 ml Lösung bzw. 400 Tropfen, entsprechend 24 ml Bier, 10 ml Wein pro 10 ml Lösung.
Gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.
Ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie
- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen.
Darf Trimipramin Sandoz während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?
Nehmen Sie Trimipramin Sandoz während der Schwangerschaft nur auf ausdrückliche Verordnung des Arztes oder der Ärztin ein, denn Trimipramin Sandoz könnte dem ungeborenen oder gestillten Kind schaden.
Der Wirkstoff von Trimipramin Sandoz geht in die Muttermilch über. Es muss abgestillt werden, wenn Sie das Medikament einnehmen müssen. Nehmen Sie in jedem Fall Kontakt mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin auf.
Wie verwenden Sie Trimipramin Sandoz?
Die Dosierung wird vom Arzt bzw. von der Ärztin für jeden Patienten bzw. jede Patientin individuell festgelegt. In der Regel beginnt man mit einer niedrigen Dosierung, die langsam gesteigert und nach Eintreten der Wirkung auf die notwendige Erhaltungsdosis reduziert wird. Die übliche tägliche Erhaltungsdosis beträgt 50–100 mg Trimipramin Sandoz (entspricht 2–4 Tabletten zu 25 mg, ½–1 Tablette zu 100 mg). Diese Tagesdosis wird entweder auf 2–3 Einzeldosen verteilt (während oder nach den Mahlzeiten) oder in einer Einmaldosis am Abend, 2 Stunden vor dem Schlafengehen, eingenommen. In gewissen Fällen, z.B. bei älteren Patienten bzw. Patientinnen, kann der Arzt bzw. die Ärztin die Erhaltungsdosis auf 25–50 mg Trimipramin Sandoz pro Tag (entspricht 1–2 Tabletten zu 25 mg) reduzieren. Schlucken Sie die Tabletten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit. Als Alternative kann der Arzt bzw. die Ärztin auch Tropfen verschreiben (1 Tropfen entspr. 1 mg Trimipramin).
Trimipramin Sandoz Tropfen werden mit etwas Wasser während oder nach den Mahlzeiten eingenommen, Flasche beim Tropfen senkrecht halten! Nicht schütteln! Zum Antropfen evtl. leicht auf den Flaschenboden klopfen.
Trimipramin Sandoz darf bei Patienten bzw. Patientinnen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.
Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.
Welche Nebenwirkungen kann Trimipramin Sandoz haben?
Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Trimipramin Sandoz auftreten:
Müdigkeit und Schwindel, gelegentlich auch Benommenheit, Zittern, Unruhe, Schlafstörungen, Schläfrigkeit, Sprechstörungen (Dysarthrie), Kopfschmerzen, hoher Blutzuckerspiegel, Herzfunktionsstörungen (Herzrhythmusstörungen), Bauchbeschwerden und Entzündung der Mundschleimhaut. In gewissen Fällen können Mundtrockenheit, verschwommenes Sehen, Wallungen, Schweissausbruch, Verstopfung und Schwierigkeiten beim Wasserlösen sowie Harnverhaltung vorkommen. Seltener kommt es zu allergischen Reaktionen, Juckreiz, Lichtempfindlichkeit, Hautausschlag, Schwellung im Gesicht, Blutdruckabfall, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, Launenhaftigkeit und Verwirrtheit v.a. bei älteren Patienten bzw. Patientinnen, epileptischen Anfällen, Bewegungsstörungen, Beeinträchtigung der Leberfunktion wie Gallenstauung, Gelbsucht, Leberentzündung oder erhöhten Leberfunktionswerten. In Einzelfällen wurde eine Brustvergrösserung beim Mann und Milchfluss aus der weiblichen Brust beobachtet. Eine Beeinflussung des gewohnten Sexualverhaltens ist möglich. Gewichtszunahme aufgrund der psychischen Besserung kann vorkommen.
Eine Zunahme des Auftretens von Verhaltensstörungen, einschliesslich verstärkten Risikos suizidaler Gedanken, Selbstverletzung und Suizid, wurde bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre mit Depression oder anderen psychiatrischen Störungen während der Behandlung mit Antidepressiva berichtet.
Bei Patienten welche trizyklische Antidepressiva oder selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer einnahmen, wurde ein erhöhtes Risiko von Knochenbrüchen beobachtet.
Trimipramin Sandoz kann bestimmte körpereigene Stoffe (die sog. Serotonin-Rezeptoren) hemmen. Infolge von Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln (vgl. Hinweis unter «Wann ist bei der Anwendung von Trimipramin Sandoz Vorsicht geboten?») kam es in Einzelfällen zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen, welche auf diese Eigenschaft zurückzuführen sind. Anzeichen einer solchen Wechselwirkung können Ängstlichkeit, Zittern, Krämpfe, Rötungen, Kopfschmerzen, Herzrasen, Kurzatmigkeit und Bluthochdruck sein.
Falls Sie eines der oder mehrere der folgenden Anzeichen auftreten:
- Übelkeit und Erbrechen,
- unwillkürliche Muskelkontraktionen,
- Unruhe,
- Verwirrtheit,
- Schläfrigkeit,
- Bewusstseinsstörungen,
- unwillkürliche und schnelle Augenbewegungen,
- Herzfunktionsstörungen (Herzrasen),
- Koordinationsstörungen,
- Psychosen mit visuellen Halluzinationen und Erregbarkeit,
- Koma,
- schwere Atemprobleme oder
- Krämpfe,
wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder Ihr Spital.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Was ist ferner zu beachten?
Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.
Aufbrauchfrist nach Anbruch
Nach dem erstmaligen Öffnen sind die Tropfen 12 Monate haltbar.
Lagerungshinweis
In der Originalverpackung, bei Raumtemperatur (15−25°C), vor Licht geschützt und ausser Reichweite von Kindern lagern.
Weitere Hinweise
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.
Was ist in Trimipramin Sandoz enthalten?
Wirkstoffe
Tabletten: 25 mg resp. 100 mg Trimipramin (als Trimipraminmaleat).
Tropfen zum Einnehmen, Lösung: 40 mg/ml Trimipramin (als Trimipraminmesilat).
1 Tropfen enthält 1 mg Trimipramin.
Hilfsstoffe
Tabletten: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Povidon K 25, Macrogolglycerolbehenate, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat.
Tropfen zum Einnehmen, Lösung, 1 ml entspricht 40 Tropfen und enthält: Polysorbat 80, Natriumdodecylsulfat, Ethanol 12% V/V, Pfefferminzöl, gereinigtes Wasser.
Zulassungsnummer
55835, 58449 (Swissmedic)
Wo erhalten Sie Trimipramin Sandoz? Welche Packungen sind erhältlich?
In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.
Tabletten
Packung mit 50 und 200 Tabletten zu 25 mg (teilbar).
Packungen mit 20 und 100 Tabletten zu 100 mg (teilbar).
Tropfen zum Einnehmen, Lösung
Flaschen zu 30 ml zu 40 mg/ml.
Zulassungsinhaberin
Sandoz Pharmaceuticals AG, Risch; Domizil: Rotkreuz
Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.
Reviews (0)
Write a review

Free consultation with an experienced pharmacist
Describe the symptoms or the right drug - we will help you choose its dosage or analogue, place an order with home delivery or just consult.
We are 14 pharmacists and 0 bots. We will always be in touch with you and will be able to communicate at any time.
Bestsellers
Milupa Aptamil Pepti Syneo Can 400g
Product code: 7748334Aptamil Pepti Syneo is a special food for babies from birth who are allergic to cow's milk protein a..
55.08 CHF
Weleda Baby Calendula Wind- und Wetterbalsam 30ml
Product code: 5455461Der Weleda Baby Calendula Wind- und Wetterbalsam schützt die sensible Babyhaut intensiv bei Kälte un..
15.35 CHF
HerpoTherm herpes pen
Product code: 7798882Herpotherm® - the heating pen Cold sores are not only unattractive but can also be very painful. Th..
78.48 CHF
Bioflorin 25 Kapseln
Product code: 841277Was ist Bioflorin und wann wird es angewendet?Bioflorin wirkt bei Durchfall und reguliert die gestör..
46.52 CHF
Bisolvon Hustensirup 200ml
Product code: 4234077Was ist Bisolvon Hustensirup und wann wird es angewendet?Bisolvon Hustensirup enthält den synthetisc..
43.10 CHF
Emadine Se Augentropfen 30 Monodosen
Product code: 2602542Was ist Emadine SE und wann wird es angewendet?Emadine SE Augentropfen sind zur Behandlung der typis..
59.78 CHF